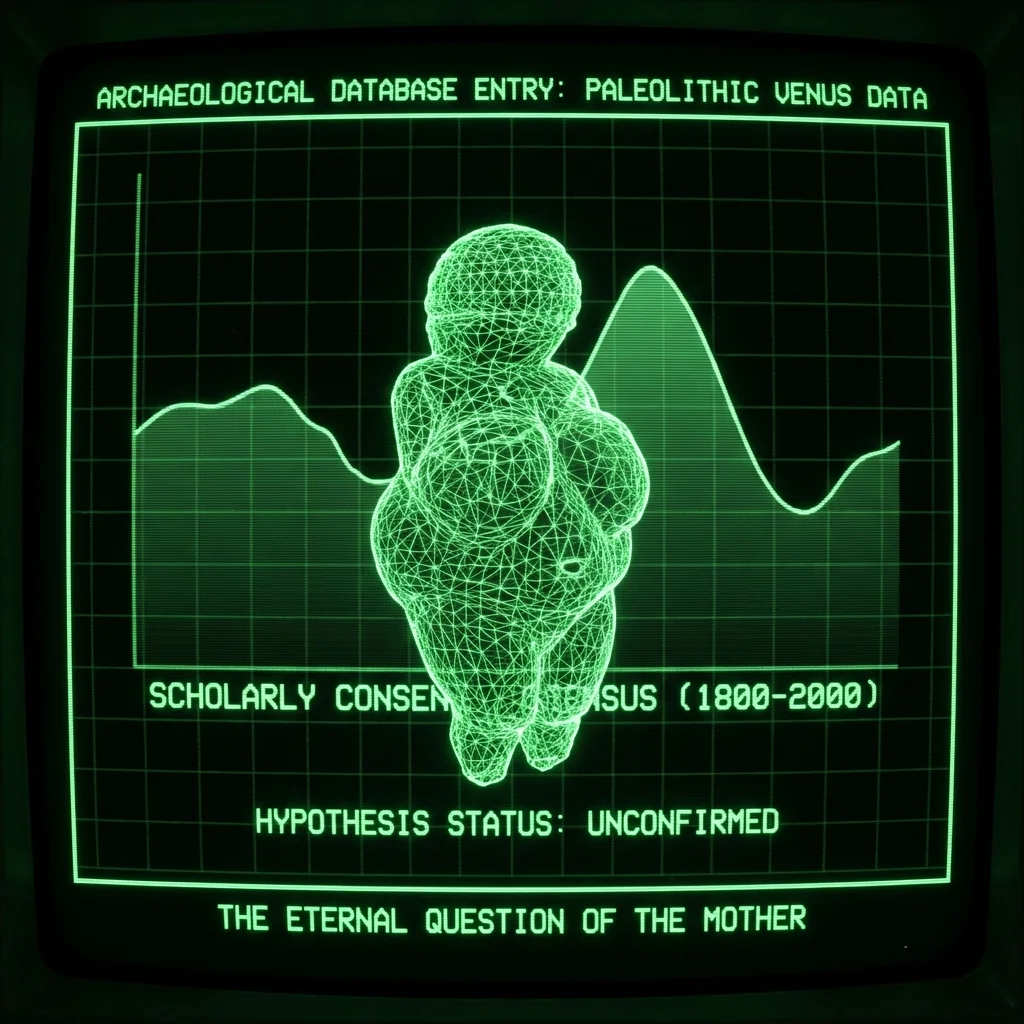TL;DR
- Weltmythen stellen oft weibliche Schöpfer dar, was Theorien über ein antikes Matriarchat (weibliche Herrschaft oder Zentralität) befeuert.
- J.J. Bachofen (1861) schlug eine universelle “Mutterrecht”-Phase vor, die Engels, Feministinnen und sogar einige Nazi-Ideologen beeinflusste, obwohl sie oft auf Interpretationen von Mythen basierte.
- Anthropologen des 19./20. Jahrhunderts debattierten darüber; Figuren wie Morgan unterstützten es, während Maine, Westermarck und später Malinowski es kritisierten und keine klaren Beweise für weibliche politische Herrschaft fanden.
- Die zweite Welle des Feminismus belebte das Interesse (z.B. Gimbutas’ “Altes Europa”), stieß jedoch auf wissenschaftliche Kritik, die den Mangel an Beweisen und alternative Interpretationen betonte (z.B. Bambergers Mythen, die das Patriarchat rechtfertigen).
- Moderne Forschung konzentriert sich auf greifbare weibliche Beiträge (Großmutter-Hypothese, kooperatives Brüten, Sprachursprünge durch Mutterese, potenzielle Rollen in Innovation/Landwirtschaft) und Primatenanalogien (Bonobos) statt auf ein wörtliches Matriarchat. Konsens: Keine bewiesenen matriarchalen Gesellschaften, aber Frauen waren entscheidende Kulturgestalterinnen.
Weibliche Schöpfer in Mythos und Kosmologie#
In den Mythologien der Welt erscheinen Frauen oft als ursprüngliche Schöpfer oder Kulturbringer. In den Erzählungen der australischen Aborigines im Traumzeit, zum Beispiel, werden den Ahnen-Schwestern die Etablierung von Gesetz und Zeremonie zugeschrieben. Die Wawilak-Schwestern von Arnhem Land “legten viel von dem Gesetz und der Zeremonie fest” für die ersten Menschen und lehrten ihnen den moralischen Kodex, der bis heute Bestand hat. Während ihrer Reise benannten diese Schwestern das Land und schufen heilige Rituale, im Wesentlichen die Gründung von Schlüsselelementen der Kultur in der Yolngu-Tradition. Ähnliche Themen tauchen anderswo auf: In der Navajo-Kosmologie ist Changing Woman eine zentrale Figur, die Zwillingskulturhelden zur Welt bringt und die Welt der “Erdoberflächenmenschen” formt, indem sie Ordnung und neue Wesen in die Schöpfung einführt. In der Shinto-Lore Japans verkörpert die Sonnengöttin Amaterasu nicht nur die lebensspendende Sonnenkraft, sondern ist mythisch die Ahnin der kaiserlichen Linie; der erste japanische Kaiser soll ihr Nachkomme sein, was einen göttlichen weiblichen Ursprung der sozialen Autorität markiert.
Diese Mythen artikulieren eine Vision von Frauen als Erzeugerinnen von Leben und Gesetz. Viele frühe Gesellschaften personifizierten die Erde oder Fruchtbarkeit als weiblich – von den Großen Muttergöttinnen des Alten Europas bis zu den “ersten Frauen”-Figuren in indigenen Legenden. Prähistorische Kunst deutet auf ähnliche Ideen hin: Die Häufigkeit paläolithischer “Venus”-Figuren hat einige Gelehrte dazu veranlasst, einen alten Kult einer Muttergöttin zu vermuten, was darauf hindeutet, dass frühe Menschen ein weibliches Schöpfungsprinzip als Quelle von Kultur und Gemeinschaft verehrten. Während die Interpretationen variieren, legten solche mythischen und symbolischen Beweise den Grundstein für spätere Theoretiker, die sich vorstellten, dass Frauen einst tatsächlich dominante Rollen in der Gesellschaft innehatten und die frühesten menschlichen Institutionen hervorbrachten.
Bachofens Mutterrecht: Eine matriarchale Vorgeschichte#
Die moderne wissenschaftliche Idee von Frauen als Begründerinnen der Zivilisation begann mit Johann Jakob Bachofens bahnbrechendem Buch von 1861, Das Mutterrecht. Bachofen, ein Schweizer Jurist und Klassizist, schlug vor, dass die menschliche Gesellschaft eine frühe gynäkratische (weiblich regierte) Phase durchlaufen habe, bevor das Patriarchat entstand. Er argumentierte, dass in der primitiven Ära der Menschheit promiskuitive Beziehungen vorherrschten (“Hetärismus”), was bedeutete, dass die Vaterschaft ungewiss war, sodass Abstammung und Erbe nur durch die Mutter verfolgt werden konnten. Laut Bachofen führte dies zu einer universellen Periode des Mutterrechts, in der Frauen – als die einzigen verifizierbaren Eltern – hohes Ansehen und Autorität genossen. Er glaubte, dass “die ersten menschlichen Gesellschaften matriarchalisch waren und durch weit verbreitete Promiskuität gekennzeichnet waren, was sich im Kult weiblicher Gottheiten widerspiegelte”. Er behandelte Mythologien, als wären sie fossile Aufzeichnungen der sozialen Evolution, und bestand darauf, dass Mythen “lebendige Ausdrücke der Entwicklungsstufen eines Volkes” sind. Zum Beispiel sah er die griechische Tragödie des Orestes – in der Orestes wegen des Mordes an seiner Mutter Klytaimnestra vor Gericht steht – als Symbol für den Sturz des Mutterrechts durch das Vaterrecht in der Antike. (In dem Stück stehen die neuen Götter Apollo und Athene auf der Seite von Orestes und legitimieren das Prinzip, dass die väterliche Linie wichtiger ist als die mütterliche, was allegorisch den Triumph des Patriarchats darstellt.) Bachofen zog auch Berichte über fremde Bräuche heran (zum Beispiel bemerkte er die mütterliche Verwandtschaft unter den Lykiern in Kleinasien) und archäologische weibliche Symbole. Aus all dem konstruierte er ein großes evolutionäres Schema kultureller Phasen: Aus dem chaotischen Hetärismus entstand eine matriarchale, erd- und fruchtbarkeitszentrierte Ära (exemplifiziert durch Landwirtschaft und Göttinnenverehrung), die schließlich durch patriarchale Ordnung ersetzt wurde.
Bemerkenswerterweise idealisierte Bachofen das matriarchale Zeitalter als eines des Friedens und der sozialen Harmonie. In seiner Sichtweise war “die matriarchale Periode der Menschheitsgeschichte eine von erhabener Größe”, in der die Werte der Frauen herrschten: Mütter inspirierten “Keuschheit und Poesie”, strebten nach Frieden und Gerechtigkeit, während sie die “wilde, gesetzlose Männlichkeit” der Männer zähmten. Er glaubte, dass dieses weibliche Prinzip die Familie und die Gesellschaft heiligte, bis es von einem aggressiveren männlichen Prinzip verdrängt wurde. Bachofens eindrucksvolle (wenn auch spekulative) Arbeit stellte den Übergang zum Patriarchat als eine tiefgreifende Revolution dar. Er schrieb zum Beispiel, dass es in der griechischen Mythologie eine göttliche Intervention – das Kommen neuer patriarchaler Götter – brauchte, um “das Wunder des Sturzes des Mutterrechts” zu vollbringen und das Vaterrecht zu etablieren.
Bachofens Theorien waren für ihre Zeit kühn und unorthodox. Sein Vertrauen auf intuitive Lesungen von Mythen und seine Behauptung, dass Legenden ein “realistisches, wenn auch verzerrtes” Bild der prähistorischen sozialen Realität bewahren, störten empirisch orientierte Gelehrte. Der angesehene finnische Anthropologe Edvard Westermarck lehnte in The History of Human Marriage (1891) Bachofens Methode ab, da er “von Bachofens Idee, dass Mythen und Legenden das ‘kollektive Gedächtnis’ eines Volkes bewahren”, beunruhigt war.
Nichtsdestotrotz pflanzte Das Mutterrecht einen Samen, der Generationen von Denkern stark beeinflussen sollte (zum Guten oder Schlechten). Wie ein Historiker bemerkt, “schuf Bachofen eine Theorie der menschlichen und kulturellen Entwicklung” mit Frauen im Zentrum, und obwohl sie zunächst vernachlässigt wurde, wurden seine Ideen später im ideologischen Spektrum in Deutschland aufgegriffen – von Sozialisten, Faschisten, Feministinnen und Antifeministen gleichermaßen.
Evolutionäre Anthropologie und die Matriarchatsdebatte (1860er–1900er)#
Bachofens These kam gerade zu dem Zeitpunkt, als Anthropologie und Sozialtheorie evolutionäre Rahmenwerke für menschliche Institutionen entwickelten. Im späten 19. Jahrhundert nahmen eine Reihe prominenter Gelehrter entweder die Vorstellung eines archaischen Matriarchats an oder argumentierten dagegen, während sie große Theorien des gesellschaftlichen Fortschritts konstruierten.
Auf der einen Seite fand Bachofen begeisterte Unterstützer unter frühen Anthropologen und Sozialtheoretikern, die nach universellen Stufen kultureller Evolution suchten. Der amerikanische Ethnologe Lewis Henry Morgan – berühmt für seine Studie der Irokesen – kam unabhängig zu dem Schluss, dass die prähistorische Gesellschaft ursprünglich um matrilineare Clans organisiert war. In Ancient Society (1877) dokumentierte Morgan, wie viele indigene Völker die Verwandtschaft durch die Mutter verfolgten und schlug vor, dass die primitive Menschheit Gruppenehe praktizierte, was die Mutterschaft zur einzigen sicheren Elternschaft machte. Er sah in den “klassifikatorischen” Verwandtschaftssystemen der amerikanischen Ureinwohner einen Hinweis darauf, dass in frühen Zeiten “die Abstammung in der weiblichen Linie” die Norm war, bevor die Monogamie und die väterliche Abstammung aufkamen. Morgans evidenzbasierter Ansatz (gestützt auf ethnografische Daten von den Irokesen, Polynesiern usw.) verlieh Bachofens Intuitionen ein gewisses empirisches Gewicht. Er überzeugte ihn davon, dass die patriarchalische, monogame Familie eine relativ späte Entwicklung in der Menschheitsgeschichte war, der eine lange Ära dessen vorausging, was er die mütterliche Clanorganisation nannte.
Der britische Anthropologe John Ferguson McLennan argumentierte ebenfalls 1865 und 1886, dass frühe Gesellschaften mütterliche Abstammung hatten; er prägte den Begriff “Exogamie” und schlug vor, dass Frauenraub und weibliche Knappheit zu Bräuchen führten, die indirekt auf ein früheres Mutterrechtssystem hinweisen. McLennan schrieb letztlich Bachofen zu, die mütterliche Abstammung als ursprünglich erkannt zu haben. Sogar der berühmte Autor von The Golden Bough, James G. Frazer, war von der Idee fasziniert – er setzte sich die Aufgabe, globale Beweise für das Matriarchat zu sammeln und versuchte, Bachofens Behauptungen mit vergleichender Folklore und Mythologie zu untermauern.
Vielleicht am einflussreichsten übernahm Friedrich Engels – der marxistische Theoretiker – die Vorstellung eines ursprünglichen Matriarchats und verwebte es in den historischen Materialismus. In Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staates (1884) zog Engels stark auf Morgan (den er für die Entdeckung der “Vorgeschichte” der Familie lobte) und auf Bachofens Einsichten zurück. Engels behauptete, dass der Niedergang des Mutterrechts eng mit dem Aufstieg des Privateigentums verbunden war. In der kommunistischen Stammesgesellschaft, so argumentierte er, hatten Frauen einen relativ hohen Status, aber als Reichtum sich ansammelte und die Vaterschaft für das Erbe wichtig wurde, ergriffen Männer die Kontrolle. Engels schrieb berühmt: “Der Sturz des Mutterrechts war die weltgeschichtliche Niederlage des weiblichen Geschlechts… die Frau wurde entwürdigt, geknechtet, … bloßes Werkzeug der Kinderzeugung.” Laut Engels leitete diese “Niederlage” der Frauen die erste Klassenungleichheit (zwischen den Geschlechtern) ein, die dann durch Klassenstratifizierungen verstärkt wurde. Er verknüpfte das Aufkommen des Patriarchats mit dem Aufkommen von erblichem Eigentum und monogamer Ehe, die zur Sicherstellung der Vaterschaftssicherheit entworfen wurde.
Engels’ dramatische Formulierung verlieh der Matriarchatshypothese in linken und feministischen Kreisen weite Verbreitung. Sie verband den Glauben an ein prähistorisches Matriarchat auch fest mit bestimmten politischen Interpretationen: Für Marxisten repräsentierte das primitive Mutterrecht eine frühe Form der kommunalen, egalitären Gesellschaft, die durch den Aufstieg der Klassengesellschaft zunichte gemacht wurde. Diese Politisierung überschattete manchmal empirische Beweise. Wie der Anthropologe Robert Lowie später bemerkte, waren Engels und andere so fasziniert von Morgans und Bachofens Vision, dass “die historische Realität einer Epoche des Matriarchats” oft angenommen wurde, anstatt bewiesen zu werden.
In der Zwischenzeit stellten andere Gelehrte die Idee eines ursprünglichen Matriarchats stark in Frage. Der englische Jurist Sir Henry Maine bestand bereits 1861 darauf, dass die grundlegende soziale Einheit der frühesten Gesellschaft die patriarchalische Familie war, nicht ein matriarchaler Clan. Maine, aus einem Hintergrund im antiken Recht kommend (und beeinflusst vom klassischen Bild der patria potestas in Rom), argumentierte, dass die väterliche Autorität und die agnatische Verwandtschaft urtümlich waren. Er betrachtete Theorien wie die von Bachofen als spekulative “Romane”, die sowohl der römischen Rechtsgeschichte als auch der Bibel widersprachen. 1891 kam Westermarcks umfangreiche Studie über die Ehe zu dem Schluss, dass, obwohl mütterliche Verwandtschaft in vielen Kulturen verbreitet war, es keine soliden Beweise für eine vergangene Ära gab, in der Frauen über Männer herrschten; er wollte “Maines patriarchalische Theorie der menschlichen Ursprünge wiederherstellen” und wies Bachofens mythische Beweise zurück. Bis zur Jahrhundertwende waren eine beträchtliche Anzahl von Anthropologen skeptisch, dass irgendeine Gesellschaft jemals ein echtes Matriarchat (im Sinne einer politischen Herrschaft von Frauen) gewesen war – eine Skepsis, die mit mehr ethnografischen Daten nur noch stärker werden würde.
Entwicklungen im frühen 20. Jahrhundert: Von der Göttinnenverehrung zur Kritik#
Um die Jahrhundertwende wurde die Matriarchatshypothese sowohl durch neue Beweise verfeinert als auch von aufkommenden Sozialwissenschaftlern angegriffen. Auf der unterstützenden Seite wandten die Klassizistin Jane Ellen Harrison und die Cambridge Ritualists Bachofens Ideen auf die antike griechische Kultur an. Harrison glaubte, dass das vorhellenische Griechenland durch eine göttinnenzentrierte Religion und vielleicht matrilineare soziale Bräuche gekennzeichnet war. In Werken wie Prolegomena to the Study of Greek Religion (1903) und Themis (1912) argumentierte sie, dass viele olympische Mythen und Rituale (der Kult der Demeter, die Geschichte der Amazonen usw.) Spuren einer früheren matriarchalen oder zumindest “matrifokalen” Epoche bewahrten. Ihre Interpretation der griechischen Kunst und Mythen postulierte ein emotionales, gemeinschaftliches, weiblich-zentriertes Substrat unter dem später männlich dominierten Pantheon. Harrison beschrieb sogar die Kultur des archaischen Griechenlands als eine des “Mutterrechts”, das durch spätere Invasionen gestürzt wurde, was mit Bachofens evolutionärem Narrativ übereinstimmt. Dies provozierte Gegenreaktionen von konservativeren Klassizisten: Gelehrte wie Lewis Farnell und Paul Shorey kritisierten Harrison scharf, oft in Begriffen, die von den Geschlechtervorurteilen ihrer Zeit geprägt waren. Sie verspotteten ihre matriarchalen Ideen als phantasievoll und beschuldigten sie, sich in das einzulassen, was einer “sex-freedom Hellenism” genannt wurde, und verbanden ihre akademischen Theorien mit dem skandalösen Konzept der Emanzipation der Frauen. Solche Reaktionen zeigen, wie die Debatte mit den zeitgenössischen Einstellungen verflochten war – Harrisons Arbeit wurde effektiv als feministische Subversion der klassischen Wissenschaft angegriffen, zu einer Zeit, als die Suffragettenbewegung in vollem Gange war.
Vielleicht die ehrgeizigste Erweiterung der These “Frauen als Begründerinnen der Kultur” in dieser Ära war Robert Briffaults The Mothers: A Study of the Origins of Sentiments and Institutions (1927). Briffault – ein in Frankreich geborener britischer Anthropologe – sammelte eine enzyklopädische Sammlung ethnografischer Beispiele, um zu argumentieren, dass fast alle grundlegenden Aspekte der Zivilisation im mütterlichen Bereich entstanden sind. Er behauptete, dass das frühe soziale Leben der Menschen von den Beiträgen der Frauen geprägt war: In seiner Sichtweise war die Familie selbst “das Produkt der Instinkte der Frau” und Frauen waren die ersten, die soziale Bindungen schufen. Briffault definierte das ursprüngliche Matriarchat nicht unbedingt als Frauen, die politisch über Männer herrschen, sondern als Frauen, die sozial zentral und kulturell kreativ sind. Er spekulierte zum Beispiel, dass die ersten Rituale und religiösen Kulte von Frauen entwickelt wurden – angesichts der weit verbreiteten Prominenz von Mondgöttinnen und Menstruationstabus kam er zu dem Schluss, dass Frauen als “die ersten Hierophanten der Mondkulte” frühe spirituelle Autorität hatten. Er formulierte auch das “Briffault’sche Gesetz”, das in seiner populären Form besagt: “Das Weibchen, nicht das Männchen, bestimmt alle Bedingungen der Tierfamilie. Wo das Weibchen keinen Nutzen aus der Verbindung mit dem Männchen ziehen kann, findet keine solche Verbindung statt.” Mit anderen Worten, dauerhafte Familien- oder Sozialeinheiten bilden sich um die Bedürfnisse und Entscheidungen der Weibchen. (Briffault stellte klar, dass er Tiere beschrieb und nicht sagte, dass die menschliche Gesellschaft identisch mit Tierharem ist. Dennoch implizierte er, dass die menschliche Familie aus mütterlicher Initiative entstand – Weibchen, die Männchen nur dann in die Gruppe lassen, wenn sie nützlich sind.)
Briffaults Werk behauptete kühn, dass Frauen die Zivilisation erfunden haben, von der Ehe und dem Kochen bis hin zu Recht und Religion. Dies war eine direkte Herausforderung für das vorherrschende Narrativ, dass männliche Aktivitäten (wie Jagen oder Werkzeugherstellung) den Fortschritt vorantrieben. Doch die Mainstream-Anthropologen der damaligen Zeit waren nicht überzeugt. Bis Ende der 1920er Jahre bewegte sich die Sozialanthropologie in Richtung Funktionalismus und Skepsis gegenüber unilinearer Evolution. Bronisław Malinowski, der die matrilinearen Trobriand-Insulaner studiert hatte, bestritt Briffaults Schlussfolgerungen. Malinowski fand heraus, dass selbst in Gesellschaften ohne Konzept der biologischen Vaterschaft (die Trobriander glaubten, Kinder würden von Ahnengeistern gezeugt), Männer keineswegs irrelevant waren – mütterliche Onkel und Ehemänner spielten eine wichtige Rolle im sozialen und politischen Leben der Gruppe. Er debattierte in den 1930er Jahren mit Briffault und argumentierte, dass frühe menschliche Familien wahrscheinlich immer bedeutende männliche Beiträge beinhalteten und dass die “mutterzentrierte” Phase übertrieben wurde. In Malinowskis Analyse gab es keine bekannte Gesellschaft, die Frauen exklusive Macht verlieh; was variierte, war, ob die Abstammung durch Mütter oder Väter verfolgt wurde, nicht eine totale “Herrschaft der Frauen” über Männer.
Darüber hinaus boten einige Gelehrte komplexere evolutionäre Modelle an. Der österreichische Ethnologe Wilhelm Schmidt schlug in den 1930er Jahren einen multilinearen Ursprung der Kultur vor: Er schlug vor, dass es drei primäre Typen prähistorischer Kulturen gab – matrilinear, patrilinear und patriarchalisch – abhängig von verschiedenen ökologischen Faktoren. Bemerkenswerterweise argumentierte Schmidt, dass die Rolle der Frauen im frühen Pflanzenanbau ihren Status erhöhen und in einigen Regionen Göttinnenverehrung fördern könnte. Dies ähnelt modernen Theorien, dass Frauen wahrscheinlich die Landwirtschaft initiierten (als Sammlerinnen, die Pflanzen domestizierten) und wichtige Technologien wie Weben und Töpferei erfanden, wodurch die neolithische Revolution katalysiert wurde. Während Schmidts Arbeit heute selten zitiert wird, zeigt sie den Versuch, sowohl Geschlecht als auch Umwelt in die Geschichte der kulturellen Ursprünge einzubeziehen, anstatt ein einziges universelles matriarchales Zeitalter zu postulieren.
Bis zur Mitte des Jahrhunderts führte das Gewicht neuer ethnografischer Beweise die meisten Anthropologen zu einer kritischen Haltung gegenüber der Matriarchatshypothese. Untersuchungen von Stammesgesellschaften fanden keine eindeutigen Beispiele für weiblich dominierte politische Systeme. Der Anthropologe Alfred Radcliffe-Brown erklärte 1924, dass “der mütterliche Clan nicht das Matriarchat ist” – d.h. matrilineare Verwandtschaft sollte nicht mit Frauen verwechselt werden, die Autorität über Männer ausüben. 1930 schlug E.E. Evans-Pritchard sogar vor, dass die ganze Vorstellung von einer alten matriarchalen Phase ein Produkt männlicher Fantasie (oder Angst) sei, nicht historische Realität. Dennoch blieb die Idee eines verlorenen weiblich geführten Zeitalters verlockend, und sie würde bald in verschiedenen ideologischen Kontexten neues Leben finden.
Ideologien und Interpretationen: Politik eines ursprünglichen Matriarchats#
Da die Frage der weiblichen Vorrangstellung in der Kultur grundlegende Fragen von Macht und Identität berührt, ist sie von Anfang an mit Ideologie verflochten. Reaktionen auf die Matriarchatsthese spiegeln oft den Zeitgeist der Ära wider – vom viktorianischen Patriarchat über das nationalsozialistische Deutschland bis hin zum Feminismus der zweiten Welle.
Viktorianische Anthropologen und Sozialtheoretiker, die patriarchale Normen aufrechterhielten, gehörten zu den ersten, die das matriarchale Modell ablehnten. Sir Henry Maines patriarchalische Theorie, die oben erwähnt wurde, kann teilweise als Verteidigung des Status quo gesehen werden: Sie stimmte mit der biblischen Erzählung der Patriarchen und mit viktorianischen sozialen Sitten überein, die annahmen, dass männliche Autorität natürlich und urtümlich war. Als Bachofens und Morgans Erkenntnisse zu zirkulieren begannen, sahen einige konservative Gelehrte sie als bedrohlich an. Die Vorstellung, dass die Vaterschaft eine späte Entdeckung war und dass die frühe Gesellschaft die Abstammung der Frauen ehrte, kollidierte mit sowohl christlichen als auch viktorianischen Überzeugungen über die gottgegebene Rolle des Vaters. Wie ein Nachschlagewerk es Anfang des 20. Jahrhunderts bissig formulierte, ist das Konzept des Matriarchats als Entwicklungsstufe “wissenschaftlich unhaltbar” und der Begriff selbst irreführend. Solche Ablehnungen deuten darauf hin, dass zu dieser Zeit das akademische Establishment die Idee weitgehend abgelehnt hatte – möglicherweise nicht nur aus empirischen Gründen, sondern weil sie tief verwurzelte patriarchale Narrative in Frage stellte.
In der deutschsprachigen Welt erlebte Bachofens Werk Anfang des 20. Jahrhunderts eine Wiederbelebung und fand unwahrscheinliche Bewunderer unter nationalistischen und faschistischen Denkern. Dies ist eine bemerkenswerte historische Wendung: Selbst als der Nationalsozialismus öffentlich den arischen Mann verherrlichte und Frauen auf “Kinder, Küche, Kirche” (Kinder, Küche, Kirche) beschränkte, waren einige Nazi-Intellektuelle von dem Mythos des antiken Matriarchats fasziniert. Gelehrte haben festgestellt, dass der “matriarchale Mythos” eine merkwürdige politische Ambidextrie hatte: Er konnte sowohl die extreme Linke (Marxisten, Feministinnen) als auch die extreme Rechte ansprechen. In den 1920er und 30er Jahren in Deutschland appropriierte verschiedene völkische (nationalistische-folkloristische) Schriftsteller Bachofen. Zum Beispiel sah Alfred Baeumler, ein prominenter Nazi-Philosoph, in der indoeuropäischen Vergangenheit eine Synergie von männlichen und weiblichen Prinzipien; er erkannte eine prähistorische Periode der Gynäkokratie an, stellte sie jedoch als edles Gegenstück zur modernen Geschlechterordnung dar. Er glaubte (wie Bachofen), dass die Unabhängigkeit der Frauen einst real war, aber zu Recht durch männliche Führung überwunden wurde – doch er schlug auch vor, dass die Wiederbelebung der spirituellen Ideale der matriarchalen Vergangenheit die Nation verjüngen könnte. Ein weiteres Beispiel ist Alfred Rosenberg, der Chefideologe der NSDAP, der in Der Mythus des 20. Jahrhunderts (1930) auf das urtümliche Matriarchat in einer verworrenen Weise verwies: Rosenberg stellte sich ein verlorenes arisches goldenes Zeitalter vor, das nicht genau matriarchalisch war, aber er hob den hohen Status von Frauen und Mutter-Symbolen unter den alten “nordischen” Völkern hervor. Nazi-Befürworter der Matriarchatstheorie rahmten sie nie als Frauen, die über Männer herrschen, sondern idealisierten die “germanische Mutterschaft” als den nährenden Kern der Volksgemeinschaft. Effektiv nutzten sie den Anschein der Antike, um die Mutterschaft zu glorifizieren – jedoch nur innerhalb einer streng ausgewogenen Geschlechterordnung, in der die männliche Kriegsführung weiterhin vorherrschte.
Es ist wichtig zu beachten, dass das Interesse der Nazis an diesen Ideen randständig und etwas widersprüchlich war. Die allgemeine Haltung des Dritten Reiches war, dass Patriarchat und männliche Dominanz natürlich waren (Hitler und Himmler glaubten sicherlich nicht an weibliche soziale Vorrangstellung). Doch wie ein Gelehrter schreibt, “fanden Bachofens Ideen über das Matriarchat selbst unter der Nazi-Führung Befürworter, trotz der Feier der arischen Männlichkeit durch das Regime.” Dieses Paradoxon veranschaulicht, wie wandelbar das matriarchale Narrativ sein kann: In den Händen der Nazis wurde es verdreht, um ein reaktionäres Ideal von Frauen als erhabene Mütter, aber politisch untergeordnet, zu verstärken. Bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs verschwanden solche Vorstellungen jedoch weitgehend aus dem offiziellen Diskurs, befleckt durch die Assoziation mit Nazi-Okkultismus und völkischer Pseudogeschichte.
In der Sowjetunion und anderen marxistischen Kontexten hatte die Matriarchatstheorie eine andere Karriere. Engels’ Autorität machte die Idee eines ursprünglichen Matriarchats (und dessen Niedergang) zu einer Art marxistischer Orthodoxie im frühen 20. Jahrhundert. Sowjetische Anthropologen und Historiker lehrten, Engels folgend, eine Abfolge gesellschaftlicher Stufen: primitiver Kommunismus mit Mutterrecht, dann Klassengesellschaft mit Vaterrecht und schließlich zukünftiger Kommunismus, der die Gleichheit wiederherstellt. In der Praxis suchte die sowjetische Forschung in den 1920er bis 50er Jahren nach Beweisen für matrilineare Clans unter den Völkern der UdSSR und darüber hinaus, wobei oft die Ergebnisse betont wurden, die in das Morgan-Engels-Rahmenwerk passten. Sie gingen jedoch nicht so weit zu behaupten, dass Frauen in diesen Gruppen herrschten – es ging mehr um gemeinschaftliche soziale Strukturen als um weibliche Dominanz. Der politische Nutzen dieses Narrativs für Marxisten war klar: Es unterstrich, dass das moderne Patriarchat (und in der Verlängerung der Kapitalismus) weder ewig noch natürlich war, sondern eine historische Entwicklung, die umgekehrt werden könnte. Dennoch begannen selbst marxistische Gelehrte wie Evelina B. Pavlovskaya im späteren 20. Jahrhundert zuzugeben, dass das “klassische Matriarchat” nie eine dokumentierte Realität war, und sie wechselten dazu, über relative Egalität in frühen Gesellschaften zu sprechen.
In den 1970er Jahren, inmitten der zweiten Welle der feministischen Bewegung, erreichte die Idee eines prähistorischen frauen-zentrierten Zeitalters ihre größte Popularität – und provozierte neue wissenschaftliche Prüfungen. Viele feministische Schriftstellerinnen, Künstlerinnen und Aktivistinnen ließen sich von der Vision einer alten Göttinnenkultur inspirieren, in der Frauen Autonomie und Respekt hatten, die in der aufgezeichneten Geschichte fehlten. Archäologische Funde und Neuinterpretationen halfen, dies zu befeuern. Besonders die litauisch-amerikanische Archäologin Marija Gimbutas entwickelte das Konzept des “Alten Europa”, einer neolithischen Zivilisation (ca. 7000–3000 v. Chr. in den Balkans und Anatolien), die sie als göttinnenverehrend, egalitär und matristisch charakterisierte. Gimbutas’ Ausgrabungen enthüllten zahlreiche weibliche Figuren und sie identifizierte Symbole, die ihrer Meinung nach auf eine vorherrschende Muttergöttinnen-Religion hinwiesen. In ihrer Sichtweise waren diese alten europäischen Gesellschaften friedlich und frauen-zentriert, bis indoeuropäische Nomaden – patriarchalische Krieger – eindrangen und eine männlich dominierte Ordnung auferlegten. Gimbutas vermied es, diese Kulturen als matriarchalisch zu bezeichnen (sie bevorzugte Begriffe wie “frauen-zentriert” oder matristisch), weil sie nicht behauptete, dass Frauen formale Macht über Männer hatten. Dennoch wurde ihre Arbeit von Feministinnen als Beweis dafür aufgegriffen, dass das Patriarchat nicht immer die Norm war.
In der Zwischenzeit malten populäre Bücher von Autorinnen wie Elizabeth Gould Davis (The First Sex, 1971) und Merlin Stone (When God Was a Woman, 1976) lebendige Bilder eines verlorenen goldenen Zeitalters des Matriarchats und der Göttinnenreligion. Sie stützten sich auf Quellen wie Bachofen, Briffault und Gimbutas (zusammen mit einer Dosis phantasievoller Rekonstruktion), um zu argumentieren, dass Frauen die ursprüngliche zivilisierende Kraft waren – Landwirtschaft, Schreiben, Medizin erfanden und in Frieden regierten – bis die Gewalt der Männer das Gleichgewicht umstürzte. Diese Werke fanden Anklang in der feministischen spirituellen Bewegung und trugen zu einem Aufschwung der Göttinnenspiritualität und neo-paganen Praxis im späten 20. Jahrhundert bei. Für einige war der Glaube an eine ferne Zeit, in der “die Frau als Gottheit verehrt wurde” und Gesellschaften frei von männlicher Dominanz waren, zutiefst ermächtigend, ein mythisches Gegen-Narrativ zum Patriarchat. In bestimmten feministischen Kreisen wurde diese “matriarchale Vorgeschichte” fast zu einem Dogma, das verwendet wurde, um eine alternative Zukunft zu imaginieren. Wie die Historikerin Cynthia Eller beobachtet, “hat in einigen feministischen Kreisen das, was ich den Mythos der matriarchalen Vorgeschichte genannt habe, als politisches Dogma geherrscht; in anderen hat es als Denkanstoß gedient; in wieder anderen hat es als Grundlage einer neuen Religion gedient.”
Diese enthusiastische Wiederbelebung löste jedoch eine kritische Reaktion von Wissenschaftlern aus, darunter viele Feministinnen, die sich Sorgen über Wunschdenken machten. Bereits 1949 hatte Simone de Beauvoir die Idee einer matriarchalen Utopie abgekühlt. In Das andere Geschlecht weist Beauvoir die Hypothese eines ursprünglichen Matriarchats als “les élucubrations de Bachofen” – “die Hirngespinste (lächerlichen Schwärmereien) von Bachofen” – zurück. Sie und andere Intellektuelle der Mitte des Jahrhunderts (wie die Anthropologin Françoise Héritier in Frankreich) argumentierten, dass, obwohl weibliche Gottheiten oder Mutter-Symbole häufig sind, es keine Beweise dafür gibt, dass Frauen als Gruppe jemals prähistorisch herrschten. 1974 veröffentlichte die Anthropologin Joan Bamberger einen berühmten Aufsatz mit dem Titel “The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society”, in dem sie Mythen aus Amazonas-Stämmen untersuchte, in denen Frauen angeblich einst Macht hatten. Bamberger fand heraus, dass diese Geschichten von Männern als warnende Erzählungen erzählt wurden – sie lehrten, dass, wenn Frauen Macht hatten, sie diese missbrauchten, was rechtfertigte, warum Männer jetzt herrschen müssen. Ihre Schlussfolgerung war, dass das matriarchale Zeitalter ein von Männern geschaffener Mythos ist, der eher Angst vor weiblicher Autonomie als historisches Gedächtnis widerspiegelt. Dies spiegelte frühere funktionalistische Interpretationen wider: Anstatt Beweise für eine tatsächliche Vergangenheit zu sein, dienen Mythen über die Herrschaft der Frauen aktuellen sozialen Zwecken (oft, um das Patriarchat zu verstärken, indem sie das Chaos von “Frauen an der Macht” zeigen).
Bis zum späten 20. Jahrhundert war der wissenschaftliche Konsens – unter Archäologen, Anthropologen und Historikern – überwältigend, dass keine bekannte Gesellschaft in der Menschheitsgeschichte ein Matriarchat im strengen Sinne war, in dem Frauen als Gruppe politische Autorität über Männer ausübten. Viele egalitäre oder matrilineare Gesellschaften existieren, aber sie sind keine Spiegelbilder “frauenbeherrschter” Kulturen. Wie die Wikigender-Enzyklopädie prägnant feststellt, wurde der Begriff Matriarchat selbst problematisch und die meisten Akademiker sahen Bachofens sequentielles Modell als “wissenschaftlich unhaltbar”. Selbst Befürworter von Theorien über Frauen in der Vorgeschichte, wie Gimbutas, vermieden das Wort Matriarchat aufgrund seiner Implikation weiblicher Dominanz und entschieden sich für nuancierte Begriffe (z.B. “matrifokal”, “gynozentrisch” usw.). Dennoch hatte die Vision eines verlorenen matriarchalen Paradieses außerhalb der Akademie die populäre Vorstellungskraft und das feministische Bewusstsein erreicht. Sie löste wertvolle Debatten über die Rolle der Frauen in der Evolution und Geschichte aus, trotz des Mangels an konkreten Beweisen für ein “Mutterzeitalter”.
Neuausrichtung auf Beweise: Anthropologie, Biologie und Sprache#
In den letzten Jahrzehnten haben Forscher aus verschiedenen Bereichen die Diskussion darauf gelenkt, was der empirische Befund über die Beiträge von Frauen zur menschlichen Geschichte aussagen kann. Anstatt zu fragen “Gab es jemals ein Matriarchat?”, untersuchen Wissenschaftler, wie weibliche Individuen und von Frauen geführte Aktivitäten in der menschlichen Evolution und der Entwicklung der Kultur entscheidend gewesen sein könnten. Dieser Ansatz verschiebt sich von ideologischen Extremen zu einem evidenzbasierten und oft nuancierteren Verständnis – einem, das Frauen als aktive Akteure in der Vorgeschichte anerkennt, auch ohne große Behauptungen über weibliche Herrschaft.
Die Primatologie hat durch die Untersuchung unserer Affenverwandten aufschlussreichen (und demütigenden) Kontext geliefert. Für einen Großteil des 20. Jahrhunderts basierten Modelle der menschlichen Evolution auf Beobachtungen von Schimpansen – patriarchalischen, aggressiven, männlich gebundenen Gesellschaften, in denen Männchen dominieren und sogar Weibchen brutal behandeln. Dies nährte die Annahme, dass der “natürliche” Zustand der Hominiden männliche Dominanz war und dass frühe Menschen in Männer-Jagdgruppen lebten. Aber die Entdeckung und das Studium von Bonobos (Pan paniscus) stellten diese Sichtweise radikal in Frage. Ab den 1990er Jahren hoben Primatologinnen wie Amy Parish hervor, dass Bonobos weiblich-zentriert sind: “Bonobos sind weiblich-dominiert und nutzen sexuellen Kontakt zwischen sowohl Männchen als auch Weibchen als eine Art sozialen Klebstoff. Und entscheidend ist, dass Weibchen starke Bindungen selbst mit Weibchen bilden, mit denen sie nicht verwandt sind.” In Bonobo-Gruppen sind Männchen weniger gewalttätig und oft die niedrigsten Ränge, wobei hochrangige ältere Weibchen und ihre Allianzen den Frieden wahren. Diese Entdeckung – “eine erstaunliche Schlussfolgerung”, dass Schimpansen und Bonobos, obwohl beide genetisch gleich nah zu uns, entgegengesetzte soziale Strukturen haben – zwang Wissenschaftler, die Unvermeidlichkeit des Patriarchats in unserer Abstammung zu überdenken. Wie die Wissenschaftsjournalistin Angela Saini bemerkt, zeigten Bonobos, dass ein matriarchales Modell in der Natur existiert, was neue Fragen über die menschliche Abstammung aufwirft: Könnten unsere frühen Hominin-Gesellschaften weniger männlich-dominiert gewesen sein als die der Schimpansen? Könnten kooperative weibliche Netzwerke entscheidend gewesen sein? Während Menschen keine Bonobos sind, öffnete diese Einsicht die Köpfe für Variabilität. Sie verlieh auch Hypothesen (wie denen von Chris Knight, unten diskutiert) Glaubwürdigkeit, die weibliche Koalition und Sexualität in der menschlichen Evolution betonen, und sie bot eine Art natürliche Analogie dafür, wie weibliche Führung in einer Primatengruppe funktionieren kann.
Die Evolutionsbiologie und Paläoanthropologie haben ebenfalls begonnen, die Rollen von Frauen in der tiefen Vergangenheit zu würdigen. Eine einflussreiche Idee ist die “Großmutter-Hypothese”, vorgeschlagen von Kristen Hawkes und anderen, die besagt, dass die menschliche Langlebigkeit (insbesondere die Menopause und die lange post-reproduktive Lebensspanne bei Frauen) sich entwickelte, weil Großmütter entscheidend zum Überleben der Enkelkinder beitrugen. Laut dieser Hypothese würden in frühen Homo sapiens-Gemeinschaften ältere Frauen, die keine Kinder mehr gebären konnten, helfen, ihre Enkel zu versorgen und zu betreuen, was es ihren Töchtern ermöglichte, das nächste Baby früher zu bekommen. Diese Großmutterpraxis würde den gesamten reproduktiven Erfolg der Gruppe erhöhen. Sie impliziert, dass die Anwesenheit unterstützender, kenntnisreicher Frauen eine treibende Kraft in der Evolution der menschlichen Lebensgeschichte war – im Wesentlichen verdankt der menschliche “Zustand” der multigenerationalen Familien und des kooperativen Kinderaufziehens prähistorischen Großmüttern. Jüngste Studien haben tatsächlich evolutionäre Vorteile des Lebens in der Nähe von Großmüttern gefunden (z.B. eine verringerte Kindersterblichkeit). Solche Erkenntnisse verschieben das Narrativ: Anstatt Mann-der-Jäger als Held der Evolution, haben wir Frau-die-Alloparent (Mitmutter oder Großmutter) als unbesungenen Helden, der den Erfolg unserer Spezies sichert.
Das Thema des kooperativen Brütens – dass Menschen der “pflegegebende Affe” sind, der auf viele Helfer angewiesen ist, um jedes Kind großzuziehen – wurde von der Anthropologin Sarah Blaffer Hrdy gefördert. Hrdy argumentiert, dass frühe menschliche Mütter nicht in der Lage gewesen wären, Nachkommen mit großen Gehirnen und langen Kindheiten allein zu entwöhnen und großzuziehen; sie brauchten Unterstützung von Verwandten (einschließlich Großmüttern und älteren Kindern). Dies förderte beispiellose Ebenen von Empathie, Kommunikation und sozialer Intelligenz unter unseren Vorfahren. Interessanterweise schließt dieser Gedankengang an den Ursprung der Kultur an: Wenn menschliche Säuglinge bedürftig und sozial sind und wenn Mütter Hilfe rekrutieren, dann könnte die Grundlage der sozialen Kooperation und vielleicht der Sprache in Mutter-Kind- (und Mutter-Verwandten-) Interaktionen liegen. Tatsächlich schlägt ein jüngster Gelehrter, Sverker Johansson, aufbauend auf Hrdys Arbeit vor, dass die Evolution der Sprache viel der weiblichen Kooperation verdanken könnte. Er stellt fest, dass Theorien, die sich auf männlichen Paarungskonkurrenz konzentrieren, nicht mit den Beweisen übereinstimmen: “Eine häufige Hypothese, dass Sprache durch sexuelle Selektion – Männer, die um die Aufmerksamkeit von Frauen konkurrieren – entstanden ist, kann verworfen werden. Frauen und Männer sprechen gleichermaßen gut. Und das bedeutet, dass eine Erklärung für die Sprache geschlechtsneutral oder nahezu genug sein muss.” Stattdessen postuliert Johansson, dass Sprache entstand, um gruppenweite Kooperation bei der Kinderbetreuung und anderen sozialen Aufgaben zu erleichtern. Er führt ein, was er den “Schimpansentest” nennt: Jede Theorie des Sprachursprungs muss erklären, warum andere Primaten (wie Paviane oder Schimpansen), die ebenfalls in Gruppen leben, keine Sprache entwickelt haben. Seine Antwort ist, dass frühe Menschen eine einzigartige Situation hatten – vielleicht im Zusammenhang mit schwierigen Geburten und der Notwendigkeit von Hebammen. Er weist auf die Tatsache hin, dass menschliche Babys aufgrund des aufrechten Gangs und großer Gehirne oft Hilfe bei der Geburt benötigten und Neugeborene hilflos sind. So erweisen sich Hebammen und Großmütter als Schlüssel in seinem Szenario. In Johanssons Sichtweise könnte sich die Sprache zuerst unter Frauen (Müttern und anderen Betreuern) als Kommunikationssystem entwickelt haben, um sich gegenseitig zu helfen (“Jetzt drücken!” “Wasser bringen!” oder um Säuglinge zu beruhigen). Über viele Generationen könnten diese mütterlichen Vokalisationen komplexer geworden und von der ganzen Gemeinschaft geteilt worden sein. Dies stimmt stark mit der “Muttersprachen-Hypothese” überein, die zuvor von der Anthropologin Dean Falk vorgeschlagen wurde, die vorschlug, dass die allerersten Wörter aus Mutter-Kind-“Babysprache” entstanden. Laut Falk, als frühe Hominin-Mütter ihre Babys zum Sammeln ablegen mussten, beruhigten und besänftigten sie sie mit melodischen Vokalisationen (ein Vorläufer von Schlafliedern oder beruhigender Sprache). Diese emotionalen Klänge – im Wesentlichen eine alte Form der Mutterese – erwarben allmählich Bedeutung und Struktur und legten den Grundstein für die echte Sprache. Im Laufe der Zeit, was als Kommunikation zwischen Mutter und Kind begann, erstreckte sich auf die breitere Familie und Bande und wurde zu einer voll entwickelten Sprache, die von allen geteilt wurde.
Solche Hypothesen unterstreichen, dass die sozialen und pflegenden Aktivitäten von Frauen treibende Faktoren in der Evolution der menschlichen symbolischen Kultur gewesen sein könnten. Sie sind in realistischer Evolutionsbiologie verankert, anstatt in romantischem Mythos, aber sie heben dennoch die Bedeutung von Frauen in der Geschichte dessen hervor, “was uns menschlich macht”.
Ein weiteres Interessengebiet ist Innovation und Technologie: Archäologisch gesehen stammen einige der frühesten kulturellen Erfindungen wahrscheinlich von Frauen. Zum Beispiel wird die Erfindung von Behältern (geflochtene Körbe, Töpferei) oft Sammler-Handwerkerinnen zugeschrieben, vermutlich Frauen in vielen paläolithischen und mesolithischen Kontexten. Die Entwicklung der Landwirtschaft im Neolithikum wird weithin angenommen, von weiblichen Sammlerinnen initiiert worden zu sein, die mit dem Pflanzen von Samen experimentierten. Die Domestikation von Tieren könnte auch etwas den Frauen zu verdanken haben, die als Betreuerinnen von Kleintieren oder als diejenigen, die sich um verwaiste Tiere kümmerten, fungierten. Während direkte Beweise spärlich sind, stimmt dies mit Schmidts Beobachtung überein, dass “Frauen an der frühesten Kultivierung von Pflanzen beteiligt waren” und dass dies ihre soziale Bedeutung erhöhte, was möglicherweise zur Göttinnenverehrung in frühen landwirtschaftlichen Gemeinschaften führte. Sogar die Kontrolle des Feuers und die Erfindung des Kochens – entscheidende Meilensteine in der menschlichen Kultur – können teilweise dem weiblichen Einsatz zugeschrieben werden: Der Primatologe Richard Wranghams “Kochhypothese” argumentiert, dass das Beherrschen des Feuers zum Kochen von Nahrung entscheidend für die menschliche Evolution war, und in vielen Sammlergesellschaften sind Frauen die primären Hüterinnen des Herdes und des Wissens über Pflanzenkost. Obwohl wir nicht wissen können, welches Geschlecht zuerst Wasser kochte oder Yamswurzeln röstete, ist es vernünftig anzunehmen, dass weibliche Ernährungswissenschaftlerinnen eine ebenso große Rolle wie männliche Jäger in der prähistorischen Küche spielten.
Eine moderne Theorie, die Frauen explizit ins Zentrum der Geburt der Kultur stellt, ist die provokative Arbeit von Chris Knight. In Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture (1991) synthetisiert Knight Anthropologie, Evolutionsbiologie und Mythologie, um zu argumentieren, dass die erste menschliche symbolische Kultur durch die Solidarität der Frauen geschaffen wurde. Auf der Idee eines “Sex-Streiks” aufbauend, schlägt Knight vor, dass frühe menschliche Weibchen ihre Ovulation und Menstruation synchronisierten (vielleicht mit Mondzyklen als Uhr) und kollektiv den sexuellen Zugang zu Männchen zu bestimmten Zeiten verweigerten, um Männchen zur Kooperation beim Jagen und Teilen von Fleisch zu zwingen. Laut Knights Hypothese führte dies zu den ersten Ritualen und Tabus – zum Beispiel Menstruationstabus, rot bemalte Körper, die Blut symbolisieren, und die ritualisierte Teilung der Zeit in “weibliche” (verbotene) und “männliche” (offene) Phasen. Er stellt sich vor, dass während des Oberen Paläolithikums (vor etwa 40.000 Jahren) diese von Frauen geführte Streik-und-Feier-Dynamik die sogenannte “symbolische Revolution” antrieb, die viele Archäologen identifizieren (die plötzliche Vermehrung von Kunst, persönlichem Schmuck, komplexen Bestattungsriten usw.). In Knights Szenario schmiedete die kollektive Aktion der Frauen den Gesellschaftsvertrag: Jäger kehrten mit Fleisch zurück, das während post-menstrueller Feste verteilt wurde, was ein neues Maß an Allianz zwischen den Geschlechtern zementierte, aber zu den Bedingungen der Frauen. Wie eine Zusammenfassung es ausdrückt, argumentiert Knight, dass “Frauen, durch Sex und den Rhythmus der Menstruation, den ursprünglichen kreativen Impuls der Zivilisation nährten und sie im Wesentlichen die menschliche Kultur schufen”. Die Beweise, die Knight anführt, reichen von den Gemeinsamkeiten der Schöpfungsmythen (er analysiert den Mythos der Wawilak-Schwestern der Aborigines zum Beispiel als Allegorie der Menstruationssynchronie und des Ursprungs des Rituals) bis hin zum Verhalten von Jäger-Sammlern und Primaten. Während viele Anthropologen Knights Theorie spekulativ finden, ist es ein ernsthafter Versuch zu beantworten, wie ein biologischer Affe zu einem kulturellen Menschen wurde – und es tut dies, indem es eine kooperative Gruppe von Frauen an den Brennpunkt dieses Übergangs stellt, die die Regeln und Symbole erfinden, die die Gesellschaft möglich machten.
Auf einer anderen Ebene zeigen ethnografische und soziologische Studien bestehender Gesellschaften manchmal mächtige weibliche Rollen, die möglicherweise uralte Muster widerspiegeln. Die Anthropologin Peggy Reeves Sanday identifizierte in ihrer kulturübergreifenden Untersuchung Female Power and Male Dominance (1981) mehrere Gesellschaften (von den Minangkabau in West-Sumatra bis zu bestimmten Gruppen der amerikanischen Ureinwohner), in denen Frauen beträchtliche Kontrolle über Eigentum, Erbe und Rituale genießen, obwohl sie nicht formell über Männer herrschen. Sanday verwendete den Begriff “Matriarchat” vorsichtig, um solche Fälle zu beschreiben, und definierte es nicht als Spiegelbild des Patriarchats, sondern als eine Umgebung, in der weibliche Interessen in sozialen Angelegenheiten vorherrschen. Sie kam zu dem Schluss, dass, obwohl keine bekannte Gesellschaft streng matriarchalisch ist, es ein Spektrum des weiblichen Status gibt, und einige Kulturen tatsächlich als gynozentrisch bezeichnet werden können. Zeitgenössische Beispiele wie die Mosuo in China (mit ihren matrilinearen Haushalten und “Wander-Ehen”) oder der Kabyle-Mythos weiblicher Heiliger in Algerien zeigen, dass weiblich-zentrierte soziale Organisation nicht rein eine Fantasie ist – obwohl in jedem Fall Männer immer noch einige politische oder physische Macht haben, was eine echte Umkehrung des Patriarchats verhindert.
Entscheidend ist, dass der wissenschaftliche Konsens heute die Vorstellung einer vergangenen matriarchalen Zivilisation im wörtlichen Sinne nicht unterstützt. Was er unterstützt, ist die Ansicht, dass Frauen immer integraler Bestandteil der menschlichen Geschichte waren – als Sammlerinnen und Innovatorinnen, als Trägerinnen von Kultur und Sprache und als gleichberechtigte Partnerinnen (wenn nicht sogar Anführerinnen) in wichtigen sozialen Transformationen. Wie die Encyclopedia Britannica prägnant feststellt, “wurden bisher keine anthropologischen Beweise für eine Gesellschaft gefunden, in der Frauen als Gruppe über Männer als Gruppe herrschten.” Aber es gibt reichlich Beweise für frühe Gesellschaften mit matrilinearer Verwandtschaft und wichtigen religiösen oder wirtschaftlichen Rollen für Frauen, und die Evolutionstheorie erkennt zunehmend weibliche Handlungsfähigkeit (durch Partnerwahl, Elternschaft und Kooperation) als treibende Kraft der menschlichen Evolution an. Kurz gesagt, die “Mutter der Kultur”-Hypothese in ihrer starken Form bleibt unbewiesen, aber in einer schwächeren Form – dass Mütter und Großmütter, weise Frauen und Göttinnen immer an der Grundlage dessen standen, was uns menschlich macht – findet sie beträchtliche Unterstützung.
Fazit#
Die Idee, dass Frauen die Begründerinnen des menschlichen Zustands und der Kultur waren, hat eine komplexe Reise von Mythos zu Spekulation zu wissenschaftlicher Analyse hinter sich. Sie begann im Bereich der heiligen Geschichten: Erzählungen von Göttinnen und ersten Frauen, die Welten gebaren, Gesetze verliehen und Künste lehrten. Im 19. Jahrhundert verwandelten Gelehrte wie Bachofen diese Erzählungen in eine große Theorie der Geschichte, indem sie sich ein tatsächliches Zeitalter vorstellten, in dem der Einfluss der Frauen vorherrschte und die menschliche Kultur aus dem Mutterrecht geboren wurde. Diese kühne These faszinierte viele – Morgan, Engels und andere – die sie mit aufkommendem Wissen vermischten, um zu argumentieren, dass die frühe Gesellschaft frauen-zentriert war, bis Privateigentum oder neue Götter das Gleichgewicht kippten. Im Laufe der Zeit verschoben sich sowohl die Beweise als auch die ideologischen Winde. Anthropologen sammelten Daten, die ein einfaches universelles Matriarchat widerlegten, doch der Reiz des Konzepts blieb bestehen, umgeformt durch die jeweiligen Vorlieben der Ära: Viktorianische Verteidiger des Patriarchats wiesen es zurück; totalitäre Regime appropriieren oder verdrehten es; feministische Bewegungen erfanden es als ermächtigenden Mythos neu; und Anthropologen untersuchten es erneut durch die Linse des Primatenverhaltens, von Fossilien und Verwandtschaftsstudien.
Was aus dieser Geschichte hervorgeht, ist eine reichere Wertschätzung der Rolle der Frauen in der menschlichen Evolution, die kein wörtliches matriarchales Königreich erfordert. Frauen als Schöpferinnen – des Lebens sicherlich, aber auch von Subsistenzstrategien, Sprachen des Trostes, Netzwerken des Teilens und heiligen Bedeutungen – waren immer zentral für unsere Spezies. Während unser Verständnis sich vertieft, erkennen wir, dass die Frage nicht ist, ob Frauen Urheberinnen von Aspekten der Kultur waren, sondern wie und auf welche Weise. Moderne Forschung legt nahe, dass Entwicklungen wie verlängerte Kindheit (und damit Bildung), kooperatives Brüten und Kommunikation ebenso sehr vom X-Chromosom wie vom Y-Chromosom abhängen könnten. Die “erste Frau” der Mythen mag nicht allein geherrscht haben, aber sie und ihre realen Gegenstücke unter den frühen Homo halfen, die menschliche Geschichte zu schmieden – nicht in einem goldenen Matriarchat, das ohne Spur verschwand, sondern in der dauerhaften, unverzichtbaren Arbeit, jede neue Generation zu nähren und die Bindungen zu erhalten, die Kultur möglich machen.
Quellen #
- Wawilak Sisters (Dreamtime) – Yolngu creation myth
- Changing Woman – Navajo origin myth
- Amaterasu – Japanese sun goddess & imperial ancestress
Klassische “Matriarchatsdebatte”#
- Johann Jakob Bachofen, Das Mutterrecht (1861)
- Encyclopedia overview of Bachofen & later reception
- Lewis Henry Morgan, Ancient Society (1877)
- Friedrich Engels, The Origin of the Family, Private Property and the State (1884)
- Sir Henry S. Maine, Ancient Law (1861)
- John F. McLennan, Studies in Ancient History (1886)
- Edvard Westermarck, The History of Human Marriage (1891)
- Jane Ellen Harrison, Prolegomena to the Study of Greek Religion (1903)
- Jane Ellen Harrison, Themis (1912)
- Robert Briffault, The Mothers (1931)
- Bronisław Malinowski, Sex and Repression in Savage Society (1927)
- Wilhelm Schmidt, The Origin and Spread of the World Cultures (1930)
- A. R. Radcliffe-Brown, “The Mother’s Brother in South Africa” (1924)
- E. E. Evans-Pritchard, “Some Remarks on the Early History of Kingship” (1930)
- Alfred Baeumler & Alfred Rosenberg – Nazi-era Bachofen reception (overview)
- Cynthia Eller, The Myth of Matriarchal Prehistory (2000)
- Marija Gimbutas, The Goddesses and Gods of Old Europe (1974)
- Elizabeth Gould Davis, The First Sex (1971)
- Merlin Stone, When God Was a Woman (1976)
- Peggy Reeves Sanday, Female Power and Male Dominance (1981)
- Simone de Beauvoir, The Second Sex (1949) – critique of matriarchy myths
- Joan Bamberger, “The Myth of Matriarchy: Why Men Rule in Primitive Society” (1974)
Primatologie, Kinderbetreuung & Sprachentwicklung#
- Amy Parish, “Female Relationships in Bonobos (Pan paniscus)” (1996)
- Kristen Hawkes et al., “Grandmothering, Menopause, and the Evolution of Human Life Histories” (1997) PNAS
- Sarah Blaffer Hrdy, Mothers and Others (2009)
- Sverker Johansson, The Dawn of Language (2021)
- Dean Falk, “Prelinguistic Evolution in Early Hominins: Whence Motherese?” (2004)
- Chris Knight, Blood Relations: Menstruation and the Origins of Culture (1991)
FAQ#
F 1. Was ist die Hypothese des “ursprünglichen Matriarchats”? A. Es ist die Theorie, die von J.J. Bachofen 1861 und späteren Denkern populär gemacht wurde, dass frühe menschliche Gesellschaften universell eine Phase durchliefen, in der Frauen dominante soziale, politische oder spirituelle Macht (“Mutterrecht”) innehatten, oft verbunden mit matrilinearer Abstammung und Göttinnenverehrung, bevor sie durch das Patriarchat ersetzt wurden.
F 2. Gibt es wissenschaftliche Beweise für antike matriarchale Gesellschaften? A. Nein. Während viele Mythen mächtige weibliche Figuren enthalten und einige Gesellschaften matrilinear oder matrifokal sind, ist der wissenschaftliche Konsens unter Anthropologen und Archäologen, dass keine Beweise eine vergangene Ära bestätigen, in der Frauen systematisch über Männer als Gruppe herrschten. Das Konzept wird jetzt eher als historische Theorie oder Mythos selbst angesehen.
F 3. Wenn das Matriarchat nicht real war, wie sehen Wissenschaftler heute die Rolle der Frauen in den kulturellen Ursprüngen? A. Die Forschung konzentriert sich jetzt auf spezifische, evidenzbasierte Beiträge: die “Großmutter-Hypothese” (weibliche Langlebigkeit, die das Überleben der Nachkommen unterstützt), die wahrscheinlichen Rollen der Frauen bei der Erfindung der Landwirtschaft oder früher Technologien (Töpferei, Weben), die Bedeutung der Mutter-Kind-Kommunikation bei den Sprachursprüngen (Mutterese-Hypothese) und weibliche soziale Strategien, die durch die Primatologie vorgeschlagen werden (z.B. Bonobo-Studien). Frauen werden als zentrale Akteure in der Evolution und Kultur angesehen, aber nicht unbedingt als Herrscherinnen einer verlorenen matriarchalen Welt.