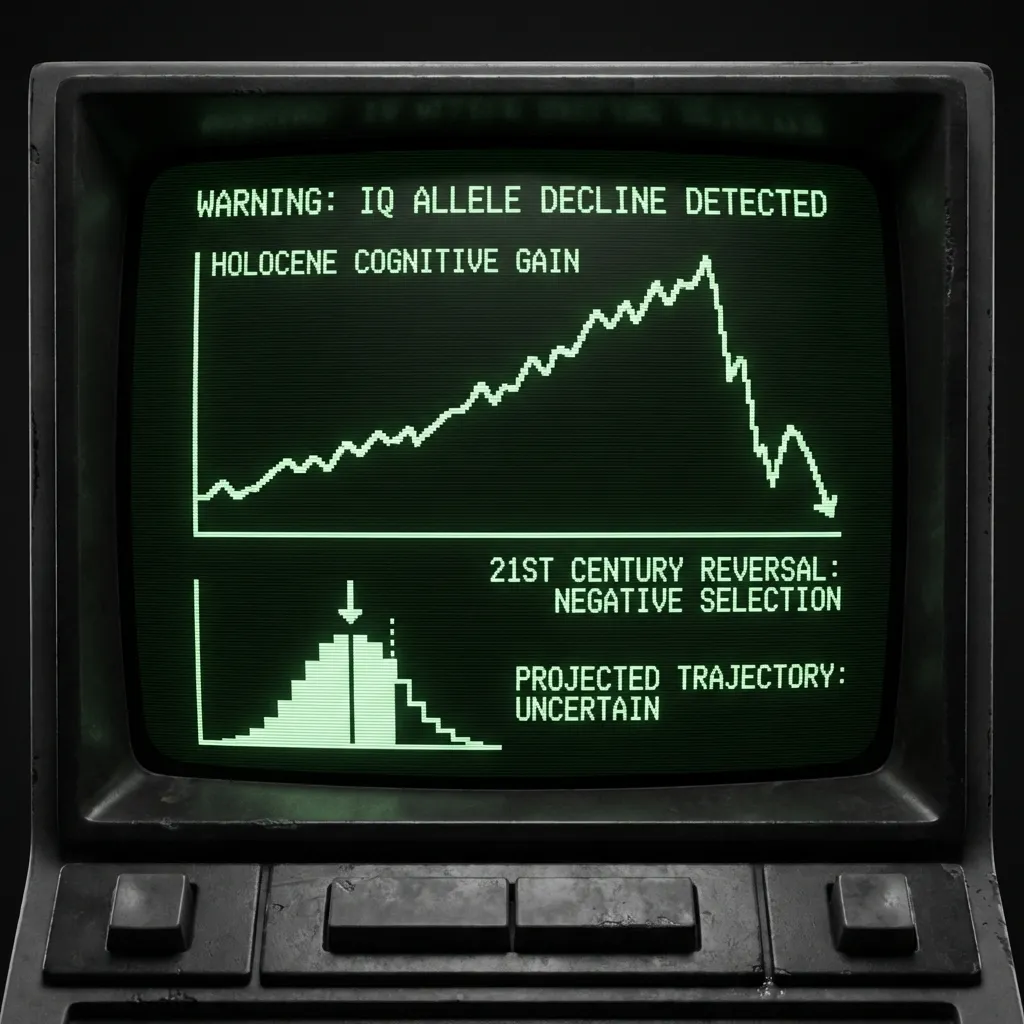TL;DR
- Alte DNA-Zeitreihen zeigen einen Anstieg der polygenen Scores für IQ/Bildungserfolg um ≈0,5 SD seit dem Neolithikum.
- Trends konvergieren in West-Eurasien, Ostasien und anderen Regionen, während Allele für Neurotizismus/Depression abnahmen.
- Die Züchtergleichung erklärt, wie schwache Selektion pro Generation über 10.000+ Jahre zu erheblichen Veränderungen führt.
- Moderne Datensätze zeigen eine jüngste Umkehrung (negative Selektion auf IQ-Allele), was beweist, dass die menschliche kognitive Evolution fortschreitet.
- Behauptungen, dass sich “genetisch im menschlichen Geist seit 50.000 Jahren nichts verändert hat”, stehen im Widerspruch zu genomischen und quantitativen genetischen Beweisen.
⸻
Alte DNA: Globale Signale kognitiver Selektion (2023–2025)#
Jüngste Studien zu alten Genomen bestätigen eine erhebliche gerichtete Selektion auf intelligenzbezogene Merkmale während des Holozäns. Mithilfe von Zeitreihen polygener Scores (PGS) – Indizes der genetischen Neigung zu komplexen Merkmalen – haben Forscher Allelfrequenzverschiebungen bei Tausenden von alten Individuen verfolgt. Das entstehende Bild zeigt, dass Allele, die mit höheren kognitiven Fähigkeiten assoziiert sind, in vielen menschlichen Populationen in den letzten ~10.000–12.000 Jahren konsistent an Häufigkeit zugenommen haben:
- West-Eurasien: Eine Studie aus dem Jahr 2024 von ~2.500 alten Genomen aus Europa und dem Nahen Osten fand “positive gerichtete Selektion für Bildungserfolg (EA), IQ und sozioökonomische Status (SES) Merkmale in den letzten 12.000 Jahren.” Polygenische Scores für EA und IQ stiegen merklich vom Oberen Paläolithikum bis zur neolithischen Ära, was darauf hindeutet, dass die kognitiven Anforderungen der frühen Landwirtschaft und Urbanisierung Selektionsdruck auf die allgemeine Intelligenz ausübten. Interessanterweise zeigen polygenische Scores für Neurotizismus und Depression einen Rückgang im Laufe der Zeit, wahrscheinlich weil Allele, die zu höherer mentaler Stabilität neigen, zusammen mit denen, die die Problemlösungsfähigkeit steigern, mitgezogen wurden (aufgrund genetischer Korrelationen zwischen diesen Merkmalen). Mit anderen Worten, während die Gene für höhere Kognition stiegen, wurden Gene, die mit negativer Affektivität verbunden sind, als Nebeneffekt tendenziell eliminiert.
- Ost-Eurasien: Parallele Ergebnisse stammen aus einer Analyse von 2025 von 1.245 alten Genomen, die das Holozän in Asien umfassen. Auch hier wurden “signifikante zeitliche Trends” mit positiver Selektion auf kognitive Merkmale – insbesondere Allele für höheren IQ und EA – in der ost-eurasischen Vorgeschichte beobachtet. Die gleiche Studie fand, dass diese Trends robust waren, selbst nachdem demografische Verschiebungen kontrolliert wurden (unter Verwendung von Admixtur- und geografischen Kovariaten). Interessanterweise wurde berichtet, dass Allele, die mit Autismus-Spektrum-Merkmalen assoziiert sind, zunahmen (möglicherweise aufgrund einer verbesserten Systematisierung oder Detailgenauigkeit), während diejenigen für Angst und Depression abnahmen, was das europäische Muster widerspiegelt. Die Selektion auf Körpergröße war kontextabhängiger und variierte nichtlinear mit dem Klima – aber der konsistente Anstieg bei Bildungs-/IQ-assoziierten Varianten deutet auf eine breite, konvergente evolutionäre Antwort in Gesellschaften hin, die neolithische Übergänge durchlaufen.
- Europa (Mainstream-Replikation): Eine Studie von Kuijpers et al. aus dem Jahr 2022 stellte genomweite PGS für verschiedene Merkmale in alten Europäern zusammen und bestätigte, dass “nach dem Neolithikum europäische Populationen einen Anstieg der Körpergröße und Intelligenz-Scores erlebten”, zusammen mit einem Rückgang der Hautpigmentierung. Diese Studie in Frontiers in Genetics verwendete GWAS-basierte polygenische Indizes für Intelligenz und fand einen anhaltenden Aufwärtstrend im kognitiven Potenzial ab ~8.000 Jahren vor heute. Bemerkenswerterweise stimmt dies mit dem archäologischen Befund überein: Die neolithische Revolution und die anschließende gesellschaftliche Komplexität schufen neue Nischen, in denen allgemeine kognitive Fähigkeiten (GCA) hoch belohnt wurden.
- Direkte Zeitreihen-Selektionstests: Ende 2024 führte ein Team unter der Leitung von Akbari et al. (einschließlich David Reich) einen leistungsstarken alten-DNA-Selektionstest ein, der nach konsistenten Allelfrequenztrends im Laufe der Zeit suchte. Bei der Anwendung auf 8.433 alte West-Eurasier (14.000–1.000 BP) identifizierten sie eine “Größenordnung mehr” Selektionssignale als frühere Methoden – etwa 347 Loci mit >99% posteriorer Wahrscheinlichkeit der Selektion. Neben klassischen Anpassungen (z.B. Laktasepersistenz) fanden sie polygenische Beweise für gerichtete Selektion auf kognitionsbezogene Merkmale. Insbesondere berichten die Autoren, dass “Kombinationen von Allelen, die heute mit… erhöhten Maßen im Zusammenhang mit kognitiver Leistung (Scores bei Intelligenztests, Haushaltseinkommen und Schuljahren)” assoziiert sind, im Laufe des Holozäns koordiniert an Häufigkeit zunahmen. Zum Beispiel scheinen Allele, die den Bildungserfolg verbessern, durch starke Selektion in West-Eurasiern, insbesondere nach ~5.000 BP, nach oben getrieben worden zu sein. Diese Ergebnisse stärken frühere Hinweise aus alter DNA, dass unsere Vorfahren laufende genetische Verbesserungen in Bezug auf Lern- und Problemlösungsfähigkeiten erlebten – auch wenn der genaue historische Phänotyp (z.B. besseres Gedächtnis, Innovation oder soziale Kognition) indirekt abgeleitet wird.
- Gehirngröße und verwandte Merkmale: Es ist bemerkenswert, dass Selektion auf Intelligenz nicht immer Selektion auf das Gehirnvolumen an sich bedeutet. Paradoxerweise hat sich das menschliche Gehirn seit dem späten Pleistozän leicht verkleinert. Die Analyse polygener Trends bestätigt einen milden Rückgang der genetischen Neigung zu größerem intrakraniellen Volumen (ICV) vom Oberen Paläolithikum bis in die jüngsten Jahrtausende. Dies spiegelt wahrscheinlich Energiekompromisse oder Selbstdomestikation wider (kleinere, effizientere Gehirne) anstatt eines kognitiven Rückschritts. Tatsächlich zeigt der ICV-PGS in Europa nur eine geringe negative Korrelation mit dem Alter (r ≈ –0,08 über 12k Jahre) und keine scharfen Verschiebungen – im Einklang mit fossilen Daten, die eine ~10%ige Reduktion der durchschnittlichen Schädelkapazität von Eiszeitjäger-Sammlern zu modernen Menschen zeigen. Kurz gesagt, unsere Gehirne könnten etwas kleiner, aber “verkabelungsoptimiert” geworden sein, während der genetische Schalter für kognitive Fähigkeiten immer noch über andere Wege nach oben bewegt wurde (z.B. synaptische Plastizität, Neurotransmissionsgene, Entwicklung des Frontalkortex usw.). Bezeichnenderweise gehören einige der stärksten holozänen Sweeps zu Loci, die mit der neuronalen Entwicklung verbunden sind. Zum Beispiel zeigt das X-Chromosom Beweise für dramatische selektive Sweeps in den letzten ~50–60k Jahren in der Nähe von Genen wie TENM1, das in die Gehirnkonnektivität involviert ist; Forscher spekulieren, dass dies eine Anpassung in Fähigkeiten wie Sprache (phonologische Rekursion) oder soziale Kognition bei Homo sapiens nach der Abspaltung von archaischen Menschen widerspiegeln könnte. Zusammenfassend liefert alte DNA eine eindrucksvolle Widerlegung der Idee, dass sich “nichts verändert hat” genetisch im menschlichen Geist – im Gegenteil, viele kleine allelische Anpassungen haben sich angesammelt, um nicht triviale Verschiebungen im kognitiven Werkzeugkasten unserer Spezies über das Holozän zu erzeugen.
Die “Keine kognitive Evolution”-Gegenargumente (und warum sie scheitern)#
Es war lange ein anthropologisches Glaubensbekenntnis, dass die menschliche Kognition einen Höhepunkt der Verhaltensmodernität vor ~50.000 Jahren erreichte, ohne weitere bedeutende biologische Veränderung seitdem. Stephen Jay Gould behauptete berühmt, dass “es in den letzten 40.000 oder 50.000 Jahren keine biologische Veränderung bei Menschen gegeben hat. Alles, was wir Kultur und Zivilisation nennen, haben wir mit dem gleichen Körper und Gehirn aufgebaut.” Ähnlich behauptete der Kognitionswissenschaftler David Deutsch kürzlich, dass prähistorische Menschen “unsere Gleichwertigen in der geistigen Kapazität waren; der Unterschied ist rein kulturell.” Dieses Blank-Slate-Katechismus – die Vorstellung, dass die Evolution für das menschliche Gehirn auf wundersame Weise gestoppt hat, während sie für Merkmale wie Krankheitsresistenz oder Pigmentierung weiterging – wird nun direkt durch Beweise widerlegt. Lassen Sie uns die wichtigsten Gegenargumente untersuchen und warum sie nicht mehr standhalten:
- “Menschen hatten keine Zeit, sich kognitiv zu entwickeln; 50k Jahre sind zu kurz.” Dieses Argument unterschätzt die Macht selbst schwacher Selektion über viele Generationen. Als Gedankenexperiment, betrachten Sie, dass ein anhaltender Selektionsunterschied von nur +1 IQ-Punkt pro Generation (weit unter dem Rauschen von IQ-Tests) mit einer Erblichkeit von ~0,5 den Mittelwert um ~+0,5 IQ pro Generation verschieben würde. In 400 Generationen (≈10.000 Jahre) wären das +200 IQ-Punkte – offensichtlich eine absurde Extrapolation. Der Punkt ist, dass es sei denn, die Selektion war buchstäblich null in jeder Generation (ein äußerst unwahrscheinlicher Zufall), selbst ein winziger anhaltender Druck könnte über Zehntausende von Jahren signifikante Veränderungen hervorrufen. Diejenigen, die darauf bestehen, dass “seit dem Pleistozän keine Veränderung stattgefunden hat”, behaupten im Wesentlichen, dass Intelligenz über 2.000+ Generationen hinweg keinen reproduktiven Vorteil gebracht hat. Um es klar zu sagen, die einzige Welt, in der die Gehirne unserer Vorfahren vor 50k Jahren eingefroren sind, ist eine, in der Intelligenz keinen Fitnessvorteil bot – eine Welt, die kein Jäger-Sammler oder Bauer erkennen würde. Realistisch gesehen hilft höhere kognitive Fähigkeit Menschen, Probleme zu lösen, Ressourcen zu erwerben und soziale Komplexitäten zu navigieren; es ist unplausibel, dass ein solches Merkmal evolutionär neutral über alle Umgebungen hinweg wäre. Die Ergebnisse der alten Genome (Abschnitt 1) zeigen entscheidend, dass es nicht neutral war, sondern unter positiver Selektion stand, wann immer sozioökologische Herausforderungen Lernen, Planung und Innovation belohnten.
- “Alle Unterschiede in kognitiven Ergebnissen sind auf Kultur, nicht auf Gene zurückzuführen.” Kulturelle Evolutionisten betonen zu Recht, dass kumulative Kultur die menschliche Leistung dramatisch steigern kann, ohne genetische Veränderungen – zum Beispiel kann weit verbreitete Schulbildung Wissen und Testergebnisse in einer Bevölkerung erhöhen (der Flynn-Effekt). Kultur und genetische Evolution schließen sich jedoch nicht gegenseitig aus; tatsächlich kooperieren sie oft. Kultur kann neue Selektionsdrücke schaffen: z.B. hat die Kultur der Milchviehhaltung Laktasegene selektiert, und ähnlich hat der Übergang zu einer komplexen agrarischen Gesellschaft wahrscheinlich Gene selektiert, die abstraktes Denken, Selbstkontrolle und langfristige Planung unterstützen. Wie der Anthropologe Joseph Henrich bemerkt, “hat sich die genetische Evolution in den letzten 10.000 Jahren beschleunigt… als Reaktion auf eine kulturell konstruierte Umgebung.” Unsere Genome passten sich an Landwirtschaft, hohe Bevölkerungsdichte, neue Diäten und Krankheiten an – warum sollten sie sich nicht auch an die neuen kognitiven Anforderungen dieser Umgebungen anpassen? Kultur puffert einige Selektionsdrücke ab, verstärkt aber andere (zum Beispiel schafft der Wert von Rechen- und Lesefähigkeit in komplexen Gesellschaften einen Fitnessvorteil für diejenigen, die schnell lernen). Tatsächlich sagt die Theorie der Gen-Kultur-Koevolution voraus, dass Merkmale wie allgemeine Intelligenz weiterhin als Reaktion auf neue Herausforderungen evolvieren würden. Die empirischen Daten bestätigen dies jetzt: Populationen mit langjährigen Traditionen dichter, technologisch fortgeschrittener Gesellschaften zeigen höhere Frequenzen von Allelen, die mit Bildungserfolg verbunden sind, als kürzlich kontaktierte Jäger-Sammler. Kultur und Gene erklommen die Leiter zusammen – ein Feedback-Loop, kein Entweder-oder.
- “Prähistorische Völker waren genauso schlau – schauen Sie sich alte Kreativität und Werkzeuge an.” Es besteht kein Zweifel, dass Menschen vor 40.000 Jahren in einem absoluten Sinne intelligent waren (sie waren biologisch Homo sapiens). Aber die wissenschaftliche Frage ist eine der Durchschnitte und inkrementellen Veränderungen, nicht eine binäre “schlau vs. dumm”. Kritiker verweisen oft auf frühe symbolische Artefakte (z.B. Ockerpigmente, Perlen von ~100kya) als Beweis dafür, dass kognitive Raffinesse lange vor 50kya vorhanden war. Diese isolierten Funde sind jedoch umstritten – viele Archäologen sehen sie als unsichere Vorläufer, wobei wirklich explosive Innovationen (Höhlenmalerei, Skulptur, komplexe Werkzeuge) erst im Oberen Paläolithikum (~50–40kya) erscheinen. Dieses Muster deutet auf ein Schwellenereignis hin – möglicherweise ein biologisches kognitives Upgrade (manchmal als genetische Mutation vermutet, die die Gehirnverdrahtung oder Sprache beeinflusst). Wenn dem so ist, dann ist es tatsächlich ein Fall für die jüngste Evolution: einige erbliche Veränderungen könnten den “großen Sprung nach vorne” in der Kultur ermöglicht haben. Allgemeiner gesagt, während alte Individuen sicherlich fähig waren, folgt daraus nicht, dass alle Populationen zu allen Zeiten das gleiche genetische Potenzial hatten. Evolution stoppt nicht an einer Ziellinie des “modernen menschlichen Verhaltens”. Zum Beispiel ist es bezeichnend, dass die frühesten Zivilisationen und Schriftsysteme in bestimmten Regionen (Fruchtbarer Halbmond, Gelber Fluss usw.) nach Jahrtausenden der Landwirtschaft entstanden – genau die Populationen, bei denen unsere genetischen Daten die stärkste Selektion für EA/IQ-Allele zeigen. Das bedeutet nicht, dass diese frühen Bauern von Natur aus schlauer waren als Sammler anderswo – es bedeutet, dass sie begonnen hatten, durch Evolution in Verbindung mit ihrem kulturellen Vorsprung ein wenig schlauer zu werden. Wir haben jetzt alte DNA-Zeitreihen, die zeigen, dass kognitive PGS in rein Jäger-Sammler-Populationen über Jahrtausende hinweg flach blieben, aber zu steigen begannen, sobald Landwirtschaft und staatliche Gesellschaften entstanden. Im Wesentlichen setzte sich die menschliche kognitive Evolution fort, bescheiden aber messbar, wo immer die kulturelle Komplexität zunahm.
- “Das Gehirnvolumen ist tatsächlich geschrumpft; bedeutet das nicht weniger Intelligenz?” Es stimmt, dass das durchschnittliche Gehirnvolumen von Homo sapiens heute (~1350 cc) unter dem der Menschen des Oberen Paläolithikums (~1500 cc) liegt. Einige Anthropologen argumentieren, dass dies auf einen Selbstdomestikationsprozess hinweist, der uns zahmer und vielleicht dümmer macht (im Vergleich zu domestizierten Tieren mit kleineren Gehirnen als ihre wilden Gegenstücke). Doch das Gehirnvolumen korreliert nur lose mit dem IQ (innerhalb moderner Menschen liegt die Korrelation bei ~0,3–0,4). Die Qualität und Organisation der neuronalen Schaltkreise sind wichtiger. Es ist durchaus plausibel, dass unsere Gehirne schlanker, aber effizienter wurden – möglicherweise spiegelt dies einen Wechsel von roher visuell-räumlicher Leistungsfähigkeit zu spezialisierteren kortikalen Netzwerken für komplexe Kognition wider. Die genetischen Beweise unterstützen diese Interpretation: Trotz eines leichten holozänen Rückgangs des Schädelvolumens stiegen Allele, die die kognitive Funktion verbessern. Zum Beispiel stellt eine alte Genom-Analyse fest, dass zahlreiche Gene für die Gehirnentwicklung (über die bloßen Kopfgrößenregulatoren hinaus) unter Selektion standen. Wir könnten es mit Computerchips vergleichen: Unsere “Hardware” wurde in gewisser Hinsicht kleiner, aber unsere “Software” (neuronale Konnektivität und Neurotransmitterabstimmung) erhielt ein Upgrade. Darüber hinaus könnte ein kleineres Gehirn in einem domestizierten, kooperativen Kontext den Energieverbrauch und die Geburtsrisiken reduzieren, während die soziale Intelligenz zunimmt. In jedem Fall hat die bescheidene Reduktion des ICV-PGS (in der Größenordnung von 0,1 SD über 10.000 Jahre) eindeutig nicht verhindert, dass die kognitiven Fähigkeiten steigen. Es ist ein nuancierter evolutionärer Kompromiss, nicht einfach ein Rückgang. (Und als scherzhafter Gegenpunkt: Wenn man wirklich denkt, dass wir alle seit der Eiszeit dümmer geworden sind, muss man zugeben, dass das Gehirn genetischen Veränderungen unterlag – was das zentrale “keine Evolution”-Argument von Anfang an untergräbt.)
- “Unterschiedliche Ergebnisse heute sind vollständig umweltbedingt, daher können Gene nicht beteiligt sein.” Dieses Argument entspringt oft einer lobenswerten Vorsicht gegenüber genetischem Determinismus, aber es verwechselt aktuelle Variation mit historischem Wandel. Ja, die Tatsache, dass (zum Beispiel) die Alphabetisierungsraten aufgrund des Zugangs zur Schulbildung unterschiedlich sind, sagt nichts darüber aus, ob sich Gene über Jahrhunderte verändert haben. Man kann die massive Rolle der Umwelt (der Flynn-Effekt hat die IQ-Werte in vielen Ländern um >2 SD durch Bildung, Ernährung usw. erhöht) voll anerkennen und gleichzeitig die zugrunde liegenden Genfrequenztrends erkennen. Tatsächlich präsentieren moderne Beobachtungen eine deutliche Warnung: Phänotyp und Genotyp können sich in entgegengesetzte Richtungen bewegen. Ein Beispiel – im 20. Jahrhundert stieg der gemessene IQ in entwickelten Ländern (Flynn-Effekt), selbst als die genetische Selektion gegen höhere IQs war (aufgrund unterschiedlicher Fruchtbarkeit). Eine kürzlich durchgeführte Analyse von US-amerikanischen Gesundheits- und Rentendaten schätzt, dass die genetische Selektion den kognitiven polygenen Score der Bevölkerung in der Mitte des 20. Jahrhunderts um etwa 0,04 SD pro Generation senkte – was ungefähr einem Verlust von –0,6 IQ-Punkten pro Generation durch dysgenische Trends entspricht, selbst wenn die tatsächlichen Testergebnisse dank Umweltverbesserungen stiegen. Mit anderen Worten, Kultur kann Genetik kurzfristig maskieren oder überwiegen. Aber über Hunderte von Generationen hinweg, wenn die Selektion konsequent bestimmte Allele begünstigt oder benachteiligt, wird das genetische Signal schließlich durchscheinen. Langfristige Evolution durch Verweis auf kurzfristige Umwelteffekte abzulehnen, ist ein Fehlschluss. Beide Faktoren waren am Werk: Die Umwelt formt den Ausdruck von Intelligenz, während die Evolution langsam aber sicher die Verteilung der intelligenzfördernden Gene formte.
Zusammenfassend ist die fest verankerte anthropologische Haltung, dass “sich seit der Steinzeit nichts verändert hat”, angesichts moderner Beweise unhaltbar. Diese Haltung hielt sich mehr als ideologisches Bekenntnis zu menschlicher Gleichheit und Exzeptionalismus als eine testbare Hypothese – sie war, wie ein Kommentator es ausdrückte, “überlebend durch Dekret, nicht durch Daten.” Heute haben wir die Daten. Alte Genome, Selektionstests und quantitative Genetik haben sich darauf geeinigt, dass die menschliche kognitive Evolution bis ins Holozän und sogar in die historische Ära hinein messbar fortgesetzt wurde. Die Veränderungen waren inkrementell, verwandelten unsere Vorfahren nicht in Idioten (sie waren eindeutig intelligent genug, um zu überleben und zu innovieren), aber sie waren gerichtet – und widerlegen die Idee einer flachen intellektuellen Landschaft, die in der Zeit eingefroren ist.
Die Züchtergleichung, Schwellen und langfristige Veränderungen#
Die Züchtergleichung aus der quantitativen Genetik bietet eine einfache Linse, um zu quantifizieren, wie viel evolutionäre Veränderung wir bei einem Merkmal unter Selektion erwarten. Sie lautet:
[\Delta Z = h^2 , S]
wobei ΔZ die Veränderung des Merkmalsmittelwerts pro Generation ist, h² die Erblichkeit des Merkmals und S der Selektionsunterschied (der Unterschied im Merkmalsmittelwert zwischen reproduzierenden Individuen und der Gesamtpopulation). Diese elegante Formel – im Wesentlichen eine Ein-Schritt-Prognose der Reaktion auf Selektion – hat einige tiefgreifende Implikationen, wenn sie über viele Generationen hinweg erweitert wird, insbesondere für ein hochpolygenes Merkmal wie Intelligenz.
Lassen Sie uns dies im Kontext menschlicher kognitiver Merkmale aufschlüsseln:
- Selbst schwache Selektion kann große Effekte haben, wenn genug Zeit gegeben ist. Angenommen, eine Population hat einen sehr bescheidenen positiven Selektionsunterschied auf Intelligenz – sagen wir, Eltern sind im Durchschnitt nur 0,1 SD (etwa 1,5 IQ-Punkte) über dem Bevölkerungsdurchschnitt. Selbst bei moderater Erblichkeit von 0,5 würde sich der durchschnittliche IQ pro Generation um ΔZ = 0,5 * 0,1 = 0,05 SD (~0,75 IQ-Punkte) verschieben. Das scheint vernachlässigbar – kaum wahrnehmbar in einer Generation. Aber summieren Sie es über 100 Generationen (≈2.500 Jahre): Wenn die Umwelt und das Selektionsregime ungefähr konsistent blieben, würden Sie ~5 SD Veränderung ansammeln (0,05 * 100) – d.h. ein Anstieg von 75 IQ-Punkten! Natürlich schwanken in der Realität die Selektionsstärken; es könnte auch Kompromisse geben, die unbegrenzte Veränderungen begrenzen. Aber die Kernidee ist, dass evolutionäre Trägheit ein Mythos ist – kleine gerichtete Schübe, wenn sie anhalten, führen zu sehr großen Ergebnissen. Unser 50.000-Jahres-Zeitrahmen umfasst ~2.000 menschliche Generationen. Es ist reichlich Zeit für signifikante kognitive Evolution, selbst unter sanften Selektionsdrücken.
- Umgekehrte Selektion kann ebenso Gewinne erodieren. Die gleiche Mathematik gilt in die entgegengesetzte Richtung. Wie oben erwähnt, kehrte sich im 20. Jahrhundert der Selektionsunterschied auf Bildung/IQ in vielen Gesellschaften um (aufgrund einer Kombination von Faktoren wie niedrigerer Fruchtbarkeit von hochgebildeten Individuen). Schätzungen aus genomischen Daten in den USA deuten auf S ≈ –0,1 SD für EA in den letzten Generationen hin, was ΔZ ≈ –0,05 SD pro Generation genotypisch impliziert. Über nur 10 Generationen (~250 Jahre) würde das zu einer –0,5 SD Veränderung kumulieren, was vielleicht ~7 oder 8 IQ-Punkte genetisches Potenzial rückgängig macht. Dies ist nicht nur hypothetisch – es ist eine Trajektorie, auf der wir uns empirisch befinden. Die Züchtergleichung sagt also nicht nur den schnellen Anstieg eines Merkmals unter positiver Selektion voraus, sondern auch seinen Rückgang unter Entspannung oder Umkehrung der Selektion. Diese Dualität ist entscheidend für die Interpretation der Vergangenheit. Wenn man argumentiert, dass keine kognitive Evolution in der Vorgeschichte stattfand, erfordert man implizit, dass die Selektion perfekt null oder symmetrisch schwankend war, um sich über Tausende von Generationen auszugleichen – ein außergewöhnlicher Zufall. Angesichts der Geschwindigkeit, mit der wir bereits genetische IQ-Rückgänge in den letzten zwei Generationen feststellen können, wäre es eine besondere Bitte, anzunehmen, dass prähistorische Selektion niemals positiv für IQ geneigt war. Im Gegenteil, sie neigte wahrscheinlich oft positiv (z.B. wenn intelligentere Individuen besser harte Zeiten überlebten oder in geschichteten Gesellschaften höheren Status erreichten), was den aufsteigenden genetischen Trend erklärt, der jetzt in alter DNA aufgezeichnet ist.
- Schwellenmodelle und nichtlineare Sprünge: Eine oft angesprochene Nuance ist, dass einige kognitive Fähigkeiten sich wie Schwellenmerkmale verhalten könnten – man hat entweder “genug” von einigen neuronalen Schaltkreisen, um eine Fähigkeit zu unterstützen, oder man hat es nicht. Sprache ist ein klassisches Beispiel, das in diesem Sinne argumentiert wird: Vielleicht bewirken inkrementelle Zunahmen der allgemeinen Intelligenz wenig, bis eine Schwelle überschritten wird, die syntaktische Rekursion oder echtes symbolisches Denken ermöglicht, woraufhin sich der Phänotyp qualitativ verschiebt (ein “Phasenwechsel”). Wenn solche Schwellen existieren, kann Selektion nichtlineare Effekte haben. Eine Population könnte relativ wenig offensichtliche Veränderung über Generationen hinweg sehen, dann eine plötzliche Blüte neuer Verhaltensweisen, sobald die genetische Akkumulation das Merkmal über den kritischen Punkt hinaus schiebt. Das archäologische “sapient paradox” – die Lücke zwischen anatomisch modernen Menschen ~200kya und der kulturellen Explosion ~50kya – könnte diese Dynamik widerspiegeln. Eine +5 SD Verschiebung in einem Schwellenkognitionsmerkmal ist nicht nur “mehr vom Gleichen” – es kann den Unterschied zwischen keiner Schriftsprache und spontaner Erfindung von Schriftsystemen bedeuten, oder zwischen steinzeitlicher Stagnation und einer industriellen Revolution. Diese Perspektive widerlegt die Behauptung, dass ein paar Standardabweichungen genetischer Veränderung irrelevant sind. Tatsächlich könnte ein berechneter +0,5 SD Anstieg im kognitiven PGS seit dem frühen Holozän, wenn er auf bestimmte zugrunde liegende Kapazitäten abgebildet wird, den Unterschied zwischen einer Welt mit nur spärlichen Bauerndörfern und einer Welt voller Zivilisationen ausgemacht haben. Kurz gesagt, kleine genetische Veränderungen können große kulturelle Durchbrüche vorbereiten, sobald Schwellen überschritten werden. Die menschliche Evolution ist wahrscheinlich eine Mischung aus allmählichen Trends und diesen Kipppunkt-Ereignissen.
- Landes multivariate Version – korrelierte Antworten: Die Züchtergleichung verallgemeinert sich auf mehrere Merkmale über Landes Gleichung, (\Delta \mathbf{z} = \mathbf{G} \boldsymbol{\beta}), wobei G die genetische Kovarianzmatrix ist und β der Vektor der Selektionsgradienten für jedes Merkmal. Die zentrale Erkenntnis ist, dass man eine Reaktion in Merkmal Z erhalten kann, ohne direkt auf Z zu selektieren, wenn Z genetisch mit einem Merkmal X korreliert ist, das unter Selektion steht. Wenden Sie dies auf Intelligenz an: Selbst wenn unsere Vorfahren nicht explizit “versuchten”, schlauer zu werden, könnte Selektion auf Stellvertreter oder Korrelationen dies indirekt bewirkt haben. Zum Beispiel, betrachten Sie sozialen Status oder Wohlstand in einer komplexen Gesellschaft. Wenn intelligentere Individuen tendenziell (im Durchschnitt) höheren Status erreichten oder mehr Ressourcen anhäuften und diese Individuen mehr Nachkommen hatten, würden Gene für Intelligenz durch Selektion auf sozialen Erfolg mitgezogen. Dies ist im Wesentlichen Gregory Clarks These in A Farewell to Alms (2007) – dass in mittelalterlichem England die wirtschaftlich Erfolgreichen (die in seinem Argument vorsichtiger, gebildeter und vielleicht kognitiv fähiger waren) die Armen überreproduzierten und allmählich die Merkmale der Bevölkerung verschoben. Wir haben jetzt genetische Beweise, die diese Art von korrelierter Antwort unterstützen: In einer kürzlich durchgeführten Analyse alter Genome aus England (1000–1850 CE) stiegen polygenische Scores für Bildungserfolg signifikant über diese Jahrhunderte, was auf genetische Selektion zugunsten der Merkmale hinweist, die einen in dieser Gesellschaft erfolgreich machten. Wichtig ist, dass mittelalterliche Bauern nicht herumsaßen und Partner nach IQ auswählten; vielmehr operierte die Selektion über Lebensausgänge (Alphabetisierung, Wohlstand, Fruchtbarkeit), die zufällig genetisch mit kognitiver Fähigkeit korreliert waren. Ebenso könnte Selektion für Krankheitsresistenz oder andere Fitnessmerkmale kognitive Effekte haben. (Es gibt Beweise, dass Schizophrenie-Risiko-Allele möglicherweise selektiert wurden, weil sie die allgemeine biologische Fitness reduzieren, und da diese genetisch mit kognitiver Funktion überlappen, führt ihre Entfernung zu einer Erhöhung der durchschnittlichen kognitiven Fähigkeit.) In der evolutionären Genetik kann sich jedes Merkmal, das im Netz verbunden ist, bewegen, wenn ein Teil des Netzes gezogen wird. Die Gene der menschlichen Intelligenz entwickelten sich nicht isoliert; sie ritten auf den Coattails vieler selektiver Kräfte – von Klimaanpassung bis zu sexueller Selektion für bestimmte Persönlichkeiten – alles gefiltert durch die genetische Kovarianzstruktur. Das Endergebnis war ein stetiger Marsch in unserem kognitiven polygenen Index, selbst wenn “Gehirne schlauer machen” nie das einzige Ziel der Selektion war.
Um dies in Zahlen zu verankern, betrachten Sie, was die alte DNA uns sagt. Polygenische Scores für kognitive Fähigkeit (unter Verwendung von GWAS-Treffern für IQ/EA) sind in der Größenordnung von 0,5 Standardabweichungen vom frühen Holozän bis heute gestiegen. Wenn man annimmt (großzügig), dass diese Scores, sagen wir, ~10% der Varianz im tatsächlichen Merkmal erklären, könnte ein 0,5 SD genotypischer Anstieg zu einem ~0,16 SD phänotypischen Anstieg führen (eine grobe Annäherung, da die wahre Vorhersagekraft aktueller GWAS-Treffer für IQ in diesem Bereich liegt). 0,16 SD sind etwa 2,4 IQ-Punkte. Nicht riesig – aber das ist pro 10.000 Jahre. Über 50.000 Jahre, wenn der Trend konsistent war, könnte es in der Größenordnung von 12 IQ-Punkten liegen. Interessanterweise haben einige Paläoanthropologen spekuliert, dass Menschen des Oberen Paläolithikums (die relativ einfache Werkzeuge hinterließen) möglicherweise eine etwas niedrigere durchschnittliche kognitive Kapazität für symbolisches Denken hatten als spätere Holozän-Menschen – kein Unterschied, den man in täglichen Überlebensfähigkeiten bemerken würde, aber genug, um für die Innovationsrate von Bedeutung zu sein. Ob diese spezifische Größe genau ist oder nicht, die Züchtergleichung versichert uns, dass große kumulative Veränderungen unter kleiner stetiger Selektion plausibel sind, und die alten-DNA-Daten bestätigen jetzt eine Trajektorie, die im Großen und Ganzen mit theoretischen Erwartungen übereinstimmt (z.B. ein S in der Größenordnung von 0,2 IQ-Punkten pro Generation würde die genomweiten Verschiebungen, die wir über ~400 Generationen beobachten, elegant erklären).
Moderne Selektionstrends und ihre historischen Implikationen#
Die Untersuchung der laufenden Evolution bei zeitgenössischen Menschen bietet einen ernüchternden Gegenpunkt – und einen Hinweis auf vergangene Regime. Im späten 20. und frühen 21. Jahrhundert erlebten die meisten industrialisierten Populationen eine Umkehrung der Selektion auf kognitive Merkmale. Mit Verhütung, verbesserter Kinderüberlebensrate und Wertverschiebungen kehrte sich die vorherige positive Korrelation zwischen Intelligenz und Fruchtbarkeit ins Negative um. Zum Beispiel fand eine umfassende Meta-Analyse von Lynn (1996) eine durchschnittliche IQ-Fertilitäts-Korrelation von etwa –0,2 über Dutzende von Datensätzen, was etwa –0,8 IQ-Punkte Selektion pro Generation gegen g impliziert. Direktere genomische Ansätze unterstützen dies: Hugh-Jones und Kollegen (2024) untersuchten tatsächliche polygenische Scores in US-Familien und berichteten, dass “Scores, die positiv mit Bildung korrelieren, selektiert werden”, was zu einer geschätzten genetischen Veränderung von –0,055 SD pro Generation in der kognitiven Fähigkeit führt. Dies entspricht ungefähr –0,6 IQ-Punkten, die genetisch jede Generation verloren gehen. Entscheidend ist, dass diese Ergebnisse aus einer Zeit beispielloser medizinischer und sozialer Unterstützung stammen – einer entspannten selektiven Umgebung nach historischen Maßstäben. Doch selbst in diesem komfortablen Kontext verschwand die natürliche Selektion auf genomischer Ebene nicht; sie nahm einfach eine andere Wendung (bevorzugt Merkmale, die mit früherer Geburt und niedrigerem Bildungsstand verbunden sind).
Warum ist das für die Vergangenheit wichtig? Weil es zeigt, dass menschliche Populationen niemals wirklich in einem evolutionären neutralen Gleichgewicht sind. Selektion findet immer in irgendeiner Form statt, auch wenn die moderne Gesellschaft ihre Effekte mit Technologie verschleiert. Wenn wir in der einfachsten Ära der menschlichen Existenz eine gerichtete genetische Veränderung in einem Jahrhundert messen können, wie viel kraftvoller könnte die Selektion in härteren Epochen gewesen sein? Historisch gesehen könnte hohe Intelligenz ein zweischneidiges Schwert gewesen sein: Sie könnte die Ressourcenerwerbung unterstützen (die Fitness steigern), aber auch in bestimmten Kontexten mit Kompromissen einhergehen (vielleicht eine leichte Neigung zu neurologischen oder psychiatrischen Problemen). In vormodernen Zeiten scheint das Gleichgewicht jedoch häufiger zugunsten höherer Kognition gewesen zu sein:
- Historische positive Selektion (der Fall des “Züchtens für Gehirne”): Viele Gelehrte haben auf die demografischen Muster in agrarischen Gesellschaften hingewiesen, in denen die oberen Klassen – oft mit besserem Zugang zu Ernährung, Bildung und vielleicht mit höherem durchschnittlichem Intellekt – mehr überlebende Nachkommen hatten als die unteren Klassen. Gregory Clarks Analyse englischer Familienlinien (aus Testamenten und Aufzeichnungen) zeigte, dass die wirtschaftlich Erfolgreichen im mittelalterlichen England etwa 2× so viele überlebende Kinder hatten wie die Armen, was zu einer langsamen Verbreitung von “mittelständischen” Genen in die allgemeine Bevölkerung führte. Merkmale, die in diesem Modell unter Selektion standen, umfassten Alphabetisierung, Weitsicht, Geduld und kognitiv verknüpfte Dispositionen (was Clark als “oberen Schwanz des Humankapitals” bezeichnete). Genetische Daten stützen diese Erzählung jetzt. Eine kürzlich durchgeführte alte DNA-Studie testete speziell Clarks Hypothese, indem sie polygenische Scores in Überresten aus dem mittelalterlichen und frühmodernen England untersuchte. Die Ergebnisse: ein “statistisch signifikanter positiver Zeittrend in polygenen Scores für Bildungserfolg” von 1000 CE bis 1800 CE. Das Ausmaß des Anstiegs dieser genotypischen Scores, obwohl bescheiden, ist “groß genug, um als beitragender Faktor zur industriellen Revolution zu dienen.” In einfacheren Worten, die englische Bevölkerung stieg genetisch in Merkmalen, die Lernen und Innovation förderten, was helfen könnte zu erklären, warum diese Bevölkerung für eine beispiellose wirtschaftliche/kulturelle Explosion im 18. Jahrhundert bereit war. Dies ist eine starke Bestätigung der Idee, dass die natürliche Selektion nicht im Paläolithikum endete – sie formte kognitive Fähigkeiten bis in die frühe Neuzeit hinein.
Polygenische Scores (PGS) für kognitive und soziale Merkmale in mittelalterlichen vs. zeitgenössischen englischen Genomen. Die gelben Kästchen (moderne Proben) liegen durchweg höher als die lila (mittelalterlichen) für Bildungsindizes (EA) und IQ, was auf eine genetische Verschiebung zugunsten dieser Merkmale in den letzten ~800 Jahren hinweist. Solche Befunde unterstützen empirisch Theorien, dass bescheidene Selektion in historischen Gesellschaften zu spürbaren Unterschieden kumulierte.
- Gen-Kultur-“Pendelschwünge”: Das Muster im Laufe der Zeit könnte zyklisch oder umweltabhängig sein. In extrem schwierigen Bedingungen (z.B. Eiszeit-Tundra oder Pionierbauern-Gemeinschaften) könnte das Überleben stärker von allgemeiner Intelligenz abhängen – der Fähigkeit, neue Werkzeuge zu erfinden, Nahrungsorte zu merken oder für den Winter zu planen – sodass die Selektion auf IQ stark war. In stabileren, wohlhabenderen Perioden könnten andere Faktoren (wie soziale Allianzen oder körperliche Gesundheit) wichtiger sein, was die Selektion auf IQ verdünnt. Schnell vorwärts in die postindustrielle Ära, und wir sehen ein Szenario, in dem bildungsintensive Lebensstile tatsächlich mit niedrigerem reproduktiven Output korrelieren (aus soziokulturellen Gründen), was die Selektion negativ umkehrt. Was dies nahelegt, ist, dass die Richtung der Selektion auf kognitive Merkmale nicht einheitlich über Zeit oder Raum war, aber der allgemeine langfristige Trend war aufwärts, weil während des langen Verlaufs der Vorgeschichte und frühen Geschichte jede Innovation oder Umweltherausforderung neue Vorteile für größere Gehirne oder bessere Köpfe schuf. Bis wir die moderne Ära erreichen, befinden wir uns in einer neuartigen Umgebung (leichtes Überleben, bewusste Familienplanung), in der sich dieser Trend umgekehrt hat. Wenn wir im Sinne der Züchtergleichung über die gesamte 50.000-jährige Spanne denken, trugen die ersten ~49.000 Jahre viele kleine positive ΔZ’s bei, und die letzten Jahrhunderte könnten ein kleines negatives ΔZ beitragen. Die Nettosumme ist immer noch positiv zugunsten höherer Intelligenz im Vergleich zur paläolithischen Basislinie.
- Moderne genetische Last vs. vergangene Optimierung: Ein weiterer Ansatz ist, die mutationale Last und die Rolle der Selektion beim Entfernen schädlicher Varianten zu betrachten. Das menschliche Genom akkumuliert jede Generation neue Mutationen, von denen viele neutral oder leicht schädlich sind. Ein gewisser Anteil beeinflusst wahrscheinlich die neuronale Entwicklung negativ. In hochsterblichen, hochselektiven Umgebungen der Vergangenheit könnten Individuen mit schwereren Lasten schädlicher Mutationen (einschließlich solcher, die die Gehirnfunktion beeinträchtigen) weniger wahrscheinlich überlebt oder sich fortgepflanzt haben, wodurch die genetische “Qualität” der Bevölkerung für Intelligenz hoch gehalten wurde. In modernen Populationen erlaubt entspannte Selektion, dass mehr mutationale Last bestehen bleibt (eine Hypothese zur Erklärung der steigenden Prävalenz bestimmter Störungen). Dies könnte bedeuten, dass alte Gruppen genetisch besser für eine harte Welt optimiert waren – ironischerweise mehr “fit” im darwinistischen Sinne – während wir heute mehr schwach schädliche Allele tragen (die das durchschnittliche kognitive Potenzial subtil beeinträchtigen könnten). Genomische Studien haben tatsächlich Signale gefunden, die mit reinigender Selektion auf intelligenzbezogene Gene in der Vergangenheit übereinstimmen (z.B. Allele, die die kognitive Funktion reduzieren, sind erwartungsgemäß bei niedriger Frequenz, wenn Selektion sie ausgemerzt hat). Diese Perspektive unterstreicht, dass evolutionäre Drücke wahrscheinlich unsere kognitive Architektur während der Vorgeschichte stützten, die schlimmsten Mutationen entfernten und gelegentlich neue vorteilhafte begünstigten. Unsere aktuelle Ära könnte im Gegensatz dazu eine wachsende Last tolerieren, die Selektion früher einschränkte. Die Implikation ist, dass prähistorische Menschen möglicherweise näher an ihrem theoretischen genetischen Potenzial für Intelligenz waren, als wir es unter entspannten Bedingungen zu sein beginnen – eine Umkehrung, die nur weiter hervorhebt, wie unnatürlich die Annahme “Selektion = 0” ist.
Die Integration aller Beweislinien: menschliche Intelligenz war und bleibt ein bewegliches Ziel. Alte DNA bestätigt den Anstieg der kognitiven polygenen Scores über Tausende von Jahren, während moderne Daten einen jüngsten Rückgang dokumentieren. Beide Trends sind relativ gering pro Generation – ein paar Zehntel Prozent Veränderung – doch über die tiefe Zeit summieren sie sich entscheidend. Es ist ehrlich gesagt erstaunlich, dass einige immer noch behaupten, unsere Köpfe existierten in einer evolutionären Stasisblase, immun gegen die Kräfte, die jeden anderen Aspekt des Lebens geformt haben. Die Realität ist, dass wir sehr wohl ein Produkt dieser Kräfte sind. Der schnelle kulturelle Fortschritt unserer Spezies in den letzten 50.000 Jahren war kein rein kulturelles Phänomen, das auf einem genetisch unveränderten Substrat stattfand; es war ein koevolutionärer Marsch. Jeder Fortschritt veränderte unsere selektive Landschaft, an die sich unsere Genome dann langsam anpassten, was weitere Fortschritte ermöglichte, und so weiter.
Stand 2025 ist das Urteil der Populationsgenetik, der alten Genomik und der quantitativen Biologie klar: menschliche kognitive Merkmale entwickelten sich messbar in der jüngeren evolutionären Vergangenheit. Die “Blank Slate”-Ansicht, die das menschliche Gehirn seit dem Oberen Paläolithikum als konstant behandelte, erweist sich als höfliche Fiktion – eine, die politisch tröstlich gewesen sein mag, aber nicht wissenschaftlich korrekt. Intelligenz, wie jedes andere komplexe Merkmal, reagierte auf Selektion. Die Züchtergleichung lehrte uns theoretisch, dass 50.000 Jahre reichlich Zeit für Veränderung sind; jetzt hat alte DNA uns empirisch gezeigt, dass eine solche Veränderung stattfand. In gewisser Weise sollte dies nicht überraschen – es wäre weit überraschender gewesen, wenn ein so fitnessrelevantes Merkmal wie kognitive Fähigkeit keine gerichtete Selektion erfahren hätte, als frühe Menschen neuen Herausforderungen gegenüberstanden (von Eiszeitklimaten bis hin zu agrarischem Leben).
Was bedeutet das für uns heute? Eine Implikation ist, dass menschliche Variation in kognitiven Fähigkeiten (unter Individuen und Populationen) wahrscheinlich ein evolutionäres Geschichtssignal hat und nicht ausschließlich auf die jüngste Umwelt zurückzuführen ist – ein Thema von großer Sensibilität, das jedoch mit Ehrlichkeit und Nuance angegangen werden muss. Eine weitere Implikation ist, dass die bemerkenswerten Errungenschaften unserer Spezies – Kunst, Wissenschaft, Zivilisation – auf einer sich langsam verschiebenden genetischen Leinwand aufgebaut wurden. Hätten wir mit dem exakt gleichen “Körper und Gehirn” von vor 50.000 Jahren verharrt, ist es fraglich, ob das Ausmaß der modernen Zivilisation möglich gewesen wäre. Und mit Blick auf die Zukunft, da sich die Selektionsdrücke jetzt ändern (oder sogar umkehren), müssen wir den langfristigen genetischen Verlauf von Merkmalen, die uns wichtig sind, in Betracht ziehen. Wird der zukünftige Mensch genetisch weniger geneigt sein, zu abstrakter Intelligenz, wenn die aktuellen Trends anhalten, und wenn ja, wie könnte die Gesellschaft dies kompensieren? Dies sind keine Fragen mehr des müßigen Spekulierens, sondern informiert durch echte Daten.
Um auf einer “Straussianischen” Note zu enden: Die Anerkennung, dass die menschliche kognitive Evolution im Gange ist (und kürzlich war), sollte nicht beunruhigend sein – es ist eine Bestätigung unseres Platzes im Gefüge der Natur. Weit davon entfernt, die menschliche Würde zu mindern, bereichert es unsere Geschichte: Unsere Vorfahren waren keine statischen Platzhalter für uns, sie waren aktive Teilnehmer an der Gestaltung dessen, was die Menschheit werden würde, sowohl durch Kultur als auch durch Gene. Die Realität der letzten 50.000 Jahre ist, dass die Evolution nicht aufhörte, als die Kultur begann. Menschen schufen Kultur, Kultur schuf Evolution, und der Tanz geht weiter. Die Blank Slate ist draußen; die Zahl (oder besser gesagt, der polygenische Score) ist drin. Wir entwickeln uns immer noch – und ja, das schließt unsere Gehirne ein.
Quellen#
- Akbari, A. et al. (2024). “Pervasive findings of directional selection…ancient DNA…human adaptation.” (bioRxiv preprint) – Beweise für >300 Loci unter Selektion in West-Eurasiern, einschließlich polygener Verschiebungen in kognitiven Leistungseigenschaften.
- Piffer, D. & Kirkegaard, E. (2024). “Evolutionary Trends of Polygenic Scores in European Populations from the Paleolithic to Modern Times.” Twin Res. Hum. Genet. 27(1):30-49 – Berichtet über steigende PGS für IQ, EA, SES über 12kyr in Europa; kognitive Scores +0,5 SD seit dem Neolithikum, zusammen mit Rückgängen in Neurotizismus/Depression PGS aufgrund genetischer Korrelation mit Intelligenz.
- Piffer, D. (2025). “Directional Selection…in Eastern Eurasia: Insights from Ancient DNA.” Twin Res. Hum. Genet. 28(1):1-20 – Findet parallele Selektionsmuster in asiatischen Populationen: IQ und EA PGS steigen durch das Holozän, negative Selektion auf Schizophrenie/Angst, positive auf Autismus (im Einklang mit europäischen Ergebnissen).
- Kuijpers, Y. et al. (2022). “Evolutionary trajectories of complex traits in European populations of modern humans.” Front. Genet. 13:833190 – Verwendet alte Genome, um post-neolithischen Anstieg in genetischer Körpergröße und Intelligenz zu zeigen, was die fortgesetzte Selektion auf diese polygenen Merkmale bestätigt.
- Hugh-Jones, D. & Edwards, T. (2024). “Natural Selection Across Three Generations of Americans.” Behav. Genet. 54(5):405-415 – Dokumentiert laufende negative Selektion gegen EA/IQ-Allele im 20. Jahrhundert in den USA, schätzt ~0,039 SD pro Generation Rückgang im phänotypischen IQ-Potenzial.
- Discover Magazine (2022) zu Goulds Zitat: “Human Evolution in the Modern Age” von A. Hurt – Zitiert Goulds “keine Veränderung in 50.000 Jahren”-Behauptung und stellt fest, dass die meisten Evolutionsbiologen jetzt nicht zustimmen und auf Beispiele jüngster menschlicher Anpassung hinweisen.
- Henrich, J. (2021). Interview in Conversations with Tyler – Diskutiert kulturelle Evolution und erkennt Gen-Kultur-Feedback an, stellt fest, dass die genetische Evolution in großen Populationen über die letzten 10k Jahre beschleunigt wurde (z.B. Selektion für blaue Augen, Laktosetoleranz).
- Clark, G. (2007). A Farewell to Alms. Princeton Univ. Press – Schlug die Idee der differenziellen Reproduktion im vorindustriellen England vor, die zu genetischen Veränderungen führte (unterstützt durch Piffer & Connor 2025 Preprint: genetische EA-Scores stiegen 1000–1850 CE in England).
- Woodley of Menie, M. et al. (2017). “Holocene selection for variants associated with general cognitive ability.” (Twin Res. Hum. Genet. 20:271-280) – Eine frühere Studie, die einen kleinen Satz alter Genome mit modernen vergleicht und einen Anstieg von Allelen vorschlägt, die im Laufe der Zeit mit kognitiver Funktion verbunden sind, und damit die Grundlage für größere Analysen legt.
- Hawks, J. (2024). “Natural selection on the rise.” (John Hawks Blog) – Überprüft neue alte DNA-Funde, einschließlich der Ergebnisse von Akbari et al., und betont, wie diese Daten eine Beschleunigung der menschlichen Evolution im Holozän bestätigen (wie Hawks und Mitarbeiter 2007 vorhergesagt haben).